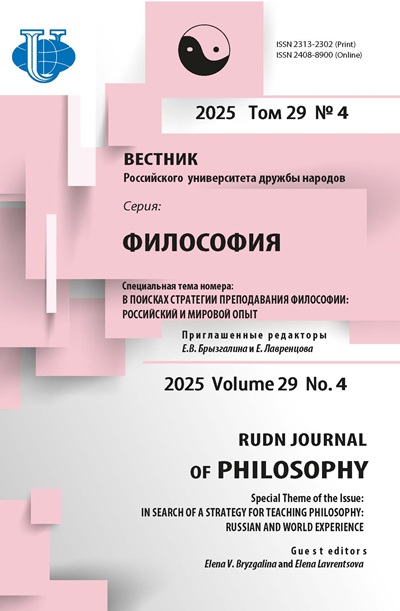Общая психология Пауля Наторпа и ее границы
- Авторы: Кноппе Т.1
-
Учреждения:
- Выпуск: Том 29, № 1 (2025): ФИЛОСОФИЯ ПАУЛЯ НАТОРПА
- Страницы: 93-104
- Раздел: ФИЛОСОФИЯ ПАУЛЯ НАТОРПА
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/43532
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2025-29-1-93-104
- EDN: https://elibrary.ru/FDQORK
- ID: 43532
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Согласно Наторпу «сознание» характеризуется непосредственным знанием, заключающимся в наличии представлений, которые могут стать познанием. «Сознательность» - это воплощение этого знания. Ему Наторп противопоставляет идею возможного сознания вообще как общего выражения явления. Она представляет собой законность явления, определение которого требует от каждого эмпирического сознания, стремящегося к мышлению познания, отличать свою «самость» от непрерывного потока своих состояний. Соответственно, «сознательность» означает кризис как нулевую точку всякой определенности, которая, правда, сама ничего не определяет, но помещает «определенность вообще» в отношение представлений сознания к мышлению как предикату «сознания вообще», которое должно быть способно сопровождать все свои представления - тем самым и те, в силу которых оно воспринимает себя в качестве мыслящего. Следовательно, нулевой точкой определения является синтетическое единство того, что можно мыслить, и того, что необходимо для его представления. Таким образом, проблема общей психологии для Наторпа состоит в том, как сделать «я мыслю» общедоступным и понятным как акт определения моего существования. Но фундаментальное значение ее вопроса представляет этика, обозначить фундаментальное значение которой, по мнению Наторпа, является последней задачей философии.
Ключевые слова
Полный текст
Paul Natorps Allgemeine Psychologie lehrt nicht, was Erkenntnis ist, sondern versucht zu klären, was es heißt, Erkenntnis zu denken. Die Frage, worauf das Denken als „allgemeine Bedingung alles Erkenntnisses überhaupt“ [1. S. 33] seiner Realität nach beruht, bringt das Bewusstsein als die Funktion des Denkens ins Spiel, die „alle unsere Vorstellungen zu Gedanken macht. [2. A 350]. Vorstellungen unterscheiden sich von Gedanken durch ihre Gewissheit, die so ursprünglich ist, „dass es vergebliches Mühen wäre, sie irgend auf etwas anderes zurückzuführen oder davon ableiten zu wollen [3. S. 182f.]. Sie qualifizieren das „unleugbar wirkliche Wunder“ [3. S. 155] der Bewusstheit, „dass was immer ich vorstelle, als Vorgestelltes, in dieser Vorstellung mir gegenwärtig sein muss“ [4. S. 342]. Damit markiert das Wunder ‚Bewusstheit’ die Grenze, an der die Allgemeine Psychologie den Meinungsgehalt meiner Vorstellungen von ihrem objektiven Erkenntnisgehalt scheidet, dessen Idee der Möglichkeit der Erfahrung in der Absicht erklärender Theorie zugrundegelegt werden muss. Ihr wechselseitige Verhältnis in der Einheit des Urteils ist der Zentralpunkt des Logischen, in dem sich das Bewusstseins als Vollzugsorgan beziehenden Denkens zu der Einsicht verbindet, dass dort, wo ein Bewusstsein sich zum Denken der Erkenntnis bestimmt, es sich schließlich selbst als die Aufgabe erkennen muss, deren Lösung das Gesetz seiner Selbstbestimmung zum Ich ist.
I
Denken, das „ganz und nur im Beziehen“ ist, ist das „im Grunde allbeherrschende Prinzip“ [3. S. 137]. Es ist der Gedanke, der als Vereinigung eines Mannigfaltigen nichts anderes „als Beziehen, also Setzen von Verhältnissen“ ist [4. S. 271].[1] Unbezüglich irgendeines beliebigen Sachverhalts bleibt sein Gedanke unthematisch. Thematisch ist er nur als das „Sein der Beziehung“; ‚Beziehung’ also ‚ist’ und „im letzten Grunde ist nur sie“ [5. S. 49]: Die „Urfunktion des Denkens“ [4. S. 113] als die „Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen […], worauf alles in Beziehung (relatione accidentis) steht“ [2. B, S. 93].[2] Für Natorps Allgemeine Psychologie bedeutet das zweierlei. Zum einen: für das sich zum Denken der Erkenntnis bestimmende Bewusstsein kann es „nichts geben, das ursprünglicher wäre als es selbst, das heißt das Setzen von Beziehung“ [4. S. 99]. Und zweitens: Ohne das Setzen von Beziehungen gibt es für kein Bewusstsein überhaupt etwas zu denken.
Hermann Cohen rekogniziert im Begriff ‚Bewusstheit’ ein antiquiertes Problem der Philosophie.[3] Wenn er ihn trotzdem verwendet, so um das Bewusstsein von dem ganz auf seine Funktionen reduzierten Denken zu unterscheiden und aus dem Katalog erkenntniskritischer Fragestellungen zu streichen.[4] Denn ganz gleich, so sein Argument, wie die Antwort auf die Frage nach der Emergenz des Bewusstseins aus Zuständen vollkommener Bewusstlosigkeit lauten mag – zuletzt befördere sie doch nur einen barbarischen Mythos.[5] Natorp pflichtet dem bei: „Man kann nicht weiter zurückfragen hinter das, was selbst Voraussetzung jedes sinnvollen Fragens ist“ [4. S. 32]. Gleichwohl relativiert er Cohens Verdikt, dass es uns nicht zu interessieren habe, wie es zugeht, dass wir ‚blau’ oder ‚cis’ empfinden[6], durch den Hinweis, dass „die Farbe, die ich (angeblich) sehe, der Ton, den ich (angeblich) höre, […] nicht die Schwingungszahl des Physikers, sondern ‚ganz etwas anderes’ [ist].“ Selbst in der weitesten Ausdehnung ihres Wissens und der weitreichendsten Vertiefung des Bewusstseins seiner Grundlagen bringen die Naturwissenschaften den Gehalt meiner Empfindung ‚blau’ bzw. ‚cis’ nicht, zumindest nicht erschöpfend zur Darstellung: „Die Angabe ‚Rot’ oder der ‚Ton gis’ ist Angabe nicht meines Sehens, meines Hörens, sondern eines ‚Was’ des Gesehenen, des Gehörten“, für dessen Darstellung die Naturwissenschaft keiner anderen als eben der Denkfunktionen bedarf, „die überhaupt auf nichts als auf die Darstellung des Objekts gerichtet sind“ [5. S. 130f.]. Geht es hingegen um mein Sehen und Hören, so steht über die Physiologie meines Sehens und Hörens hinaus deren Sinn als Empfindungen in Frage. Sinnfragen aber stellen sich allgemein. Sie zu beantworten, setzt ein klares Bewusstsein über die Bedingungen der Möglichkeit voraus, „in überzeitlichen Objektsetzungen den überzeitlichen Gehalt des Bewusstseins zu bergen und in gesetzlichem Zusammenhang darzustellen“ [3. S. 173].
Insoweit ‚Bewusstheit’ den Anfang[7] aller Bemühungen markiert, „das Verhältnis des Subjektiven und Objektiven aus seinem Ursprung verständlich zu machen“ [3. S. 61], lässt sie sich nicht länger ein antiquiertes Problem der Philosophie abtun. Ihr Begriff zeichnet im Gegenteil das Bewusstsein als allgemeines Dispositionsprinzip des Logischen aus, das die Vorstellung mannigfaltiger Bewusstseinsinhalte keineswegs ausschließt, sondern das Fragliche ihrer Bestimmtheit zum Ausdruck bringt. Als der „gemeinsame letzte Quell der unendlichen Richtungen des Erkennens“ [5. S. 36f.] bedeutet ihr Begriff ‚Gegebenheit’ als Denkbestimmung jenes Mindestmaßes von Sein, welches die Möglichkeit als den leeren Bereich sowohl für das, was bewusst ist, als auch desjenigen besagt, dem es bewusst ist. ‚Bewusstheit’ exponiert mithin das theoretische Interesse – gleichsam in der Schwebe, aber stets bereit, „da oder dorthin sich zu wenden“ [10. S. 229]: das Zentrum korrelativ aufeinander bezogener Richtungen des Erkennens im Sinne des Kantischen ‚Bewusstseins überhaupt’.[8]
II
‚Bewusstheit’ bedeutet dem sich zum Denken der Erkenntnis bestimmenden Bewusstsein den im Voraus erdachten[9] und „mit doppeltem Vorzeichen versehenen Denkpunkt“ [4. S. 50] der Darstellung des unbestimmt Bestimmbaren, das als solches anerkannt werden muss, aber „überhaupt keiner anderen Charakteristik fähig als im Vorblick auf die Bestimmung, […] die an ihm durch das Denken vollzogen werden soll“ [4. S. 41]. Dieses unbestimmt Bestimmbare ist die Erscheinung. Ihr Begriff bedeutet sowohl „das Objekt an sich selbst betrachtet (unangesehen der Art, dasselbe anzuschauen, dessen Beschaffenheit aber eben darum jederzeit problematisch bleibt)“, wie auch „die Form der Anschauung dieses Gegenstandes […], welche nicht in dem Gegenstande an sich selbst, sondern im Subjekte, dem derselbe erscheint, gesucht werden muss, gleichwohl aber der Erscheinung dieses Gegenstandes wirklich und notwendig zukommt“ [2. B, S. 55]. Mit Natorps Worten: Sie ist „weder das Erlebnis, dass mir etwas erscheint […], noch das Objekt, welches erscheint, an sich aber und abgesehen von dieser Erscheinung ‚sein’ und dasein soll; sondern genau das, als was das Objekt sich dem jedesmaligen Subjekt darstellt“ [3. S. 102]. Wenn also ‚Erscheinung’, so immer auch ‚Bewusstsein’ – und umgekehrt: wenn ‚Bewusstsein, dann immer auch ‚Erscheinung’.[10] Denn die objektive Realität der Erscheinung ist ihr Verhältnis zu einem wenigstens möglichen Bewusstsein überhaupt, das Natorp als den „Allgemeinausdruck des Erscheinens überhaupt“ [3. S. 234] deutet.
Während demnach die Konstruktion der objektiven Gegenständlichkeit dessen, was erscheint, das Erkenntnisproblem der Physik bestmmt, bedeutet Natorp das Psychische die Aufgabe, den subjektiven Sinn dieser Konstruktion objektiv zu rekonstruieren. Denn am Psychischen objektiv, wenngleich nicht physisch, ist alles, was in der Absicht erklärender Theorie ihm „zugrunde gelegt, oder auch als zu erreichendes Ziel [ihm] vorgehalten, oder in irgendeinem sonstigen Sinne als Grund oder Prinzip von [ihm] unterschieden und [ihm] gegenübergestellt wird“ [3. S. 99f.]. Denn sowohl, was erscheint, als auch das, dem es erscheint, d.i. das konkrete empirische, mithin ‚mein’ Bewusstsein, impliziert eben jenes ‚Bewusstsein überhaupt’ als den Inbegriff der Bedingungen, unter denen alles – Physisches wie Psychisches – notwendigerweise steht, sofern es nur gedacht wird. ‚Bewusstheit’ verlangt daher zu dem, „was in einer Hinsicht Erscheinung des Gegenstands, nämlich der Natur genannt wird, […] eine eigenartige Benennung“ [11. S. 33f.] zur Auszeichnung jener anderen Beziehung, die die Erscheinung des Gegenstandes auf ein überhaupt empirisches Bewusstsein hat, dem allein es Erscheinung sein kann. Die subjektiven Quellen, die die Grundlage a priori zur Möglichkeit der Erfahrung ausmachen, lassen sich daher nicht lediglich nach ihrer empirischen, sondern vor allem auch nach ihrer transzendentalen Beschaffenheit erwägen. Diese Erwägung allerdings erfordert ein Begriffssystem, dem sich das Gegenständliche der Erscheinung als Empfindung, Vorstellung, oder auch als Gedanke einordnet. Dieses Begriffssystem präsentiert Natorps Allgemeine Psychologie.
III
Wie die Konstruktion des Begriffssystems ‚Physik’, nimmt Natorps Konstruktion des Begriffssystems der Psychologie ihren Ausgang beim Faktum als dem Genitivus objectivus der Wissenschaft und bestimmt ‚Wissenschaft’ als den allgemeinen Ausdruck des „Gesetzlichen irgendwelcher Art und Richtung“ [3. S. 75]. Es ist richtungsweisend nicht nur, weil alles Bewusstsein von ihm ausgehen, sondern auch weil alle Richtungen seines theoretischen Interesses in ihm konvergieren müssen, um es zur Erscheinung zu bringen.[11] Mit anderen Worten: Das Faktum der Wissenschaft ist das Objektive, das in der Absicht erklärender Theorie als das Gesetzliche der Erscheinung nicht dem Bewusstseins, sondern dem ‚Psychologie’ genannten Begriffssystem zugrunde zu legen ist. Denn so, wie der Gegenstand der Erkenntnis außerhalb seines Verhältnisses zu einem wenigstens möglichen Bewusstsein überhaupt bedeutungslos ist, so bedeutungslos ist auch das empirische Verhältnis eines denkenden Subjekts zu seinen Zuständen. Denn diese Zustände sind ständig im Fluss und daher „in sich und aus sich zu streng identischer Bestimmung nicht fähig“ [3. S. 76]. Die Bestimmung des Gesetzlichen der Erscheinung verlangt daher von dem sie vollziehenden Bewusstsein die Unterscheidung seines ‚Selbst’ von seinen Zuständen. Denn nur dort, wo es zu dieser Unterscheidung fähig ist, kann sich ihm überhaupt die Frage erst stellen, ob, und wenn: wie es das Gesetzliche der Erscheinung des Gegenstandes der Erfahrung wie auch seiner selbst begründen kann und muss.
Dieses Problem stellt den Fragenden ins Zentrum des Erkenntnisprozesses. Dessen Darstellung impliziert „rückwärts ein Wissen, ohne das zur Frage selbst die erforderlichen Voraussetzungen fehlen würden; vorwärts ein Nichtwissen; [und] in der Mitte das Wissen des Nichtwissens, in dem besonders deutlich die Forderung und damit Vorwegnahme des Wissens liegt und welches Natorp die ganze Eigenart des Fragens eben ausmacht“ [4. S. 32]. Wem sich daher die Frage nach dem Gesetzlichen der Erscheinung stellt, dem stellt sie sich unter jeweils bestimmten und somit besonderen Bedingungen. Mehr noch: Wem sich die Frage nach dem Gesetzlichen der Erscheinung stellt, der verfügt im Allgemeinen immer auch über die Voraussetzungen, sie mit Gründen zu beantworten – auch unabhängig davon, ob ihm, d.h. dem individuellen Einzelfall bewusst ist, dass dieses sein Vermögen eine eigene, auf Grund der Mittelstellung des Wissens um das bloß Mögliche unselbständige Methode ihrer Darstellung verlangt.
Das Wissen des Nichtwissens ist die Positivität des Möglichen, an der sich der subjektive Meinungsgehalt der Erkenntnis und vom objektiven Erkenntnisgehalt der Meinung scheidet. Es qualifiziert ‚Bewusstheit’ als Krisis und bestimmt die Krisis zum Nullpunkt allen Bestimmens. Dieser Nullpunkt freilich bestimmt nicht, sondern nimmt logisch die Bestimmtheit vorweg, deren Bewährung als Grundlegung der Einheit des Wissens im „Rückgang von den objektiven Gestaltungen jeder Art“ [3. S. 212], also der ‚Physik’, ‚Sittlichkeit’, ‚Kunst’ und, wie Natorp nicht ausschließen möchte, auch der Religion als einer Art ‚Überwelt’, Aufgabe der Erkenntniskritik ist.[12] Aber Grundlegungen im Sinne bestimmender Gründe der Einheit des Wissens sind, so Natorp weiter, „samt und sonders aus der Psyche hervorgegangen“ [3. S. 212]. Insofern bedeutet ‚Bewusstheit’ nichts Einfaches, sondern den Inbegriff einer „Mannigfaltigkeit nicht bloß von einer oder einigen, sondern wahrscheinlich von unendlichen Dimensionen“ [3. S. 56].
IV
Natorps Begriff ‚Bewusstheit’ setzt die Erscheinung in die alle Richtungen des Erkennens zentrierende Mitte: „Sage ich: der Gegenstand erscheint mir, so denke ich stillschweigend dahinter den ganzen Zusammenhang der Objektivität, aus welchem diese einzelne Erscheinung nur eben jetzt hervortrete. Sage ich umgekehrt: ich stelle ihn vor, so denke ich dahinter der Zusammenhang des Bewusstseinslebens, und nun scheint diese Einzelerscheinung vielmehr aus dem verborgenen Grunde der Subjektivität nur eben jetzt hervorzutreten. Komme ich endlich dahinter, dass in jedem Falle beide Auffassungen gleich zulässig sind, so meine ich vielleicht etwas recht Kluges zu sagen, wenn ich behaupte, eine jede Erscheinung sei eben doppelseitig, objektiv und subjektiv zugleich, bedingt. In Wahrheit bedingt nicht die Objektivität die Subjektivität, noch die Subjektivität die Objektivität, noch beide als Drittes die Erscheinung, sondern die Richtung unserer Betrachtung bedingt die Auffassung der Erscheinung im objektiven oder im subjektiven Zusammenhange, die Verknüpfung beider Betrachtungsweisen ihre Auffassung als zugleich beiden Zusammenhängen angehörig“ [3. S. 194]. Die ‚Erscheinung’ schließt dementsprechend „nicht sogleich in sich ein Ich als, auch abgesehen vom Akte des Bewusstseins, für sich bestehende Substanz, sondern allein als den in diesem Akte selbst gegebenen Bezugspunkt; so wie andererseits nicht den ‚Inhalt’ als, auch abgesehen von seinem Bewusstsein, vorhandenes Objekt, sondern lediglich als den zu jenem korrelativen anderen Bezugspunkt im Akte des Bewusstseins selbst“ [3. S. 28]. Sie markiert die Grenze, auf der sich die Peripetie des theoretischen Interesses vom genitivus objectivus der Wissenschaft zum genitivus subjectivus des Bewusstseins, in Natorps Diktion: vom Faktum zum Fieri vollzieht, um das vielnamige, ewig problematische Eine[13] der Bewusstheit, des Erscheinens und der Erscheinung, des Wissens und des Subjekts zur Geltung zu bringen, dem sein Wissen die Aufgabe und den Weg der Erkenntnis bedeutet.
Dem Subjekt, dem sein Wissen die Aufgabe und den Weg der Erkenntnis bedeutet, dient das Urteil Ich denke als „Vehikel aller Begriffe überhaupt und mithin auch der transzendentalen“ und daher ausschließlich dazu, „alles Denken als zum Bewusstsein gehörig aufzuführen“ [2. B, S. 399f.]. Es unterscheidet den empirischen Inhalt seiner Vorstellungen vom Denken als Prädikat des Bewusstseins, das alle seine Vorstellungen – mithin auch die, kraft derer es sich als denkend wahrnimmt – begleiten können muss. Dass dieser Inhalt allerdings nie als etwas im Voraus Bekanntes genommen werden darf, liegt auf der Hand: Denn „wie könnte er sonst ein Problem der Psychologie sein? Was wir hätten, brauchten wir doch nicht erst zu suchen“ [3. S. 47]. So wird ‚Bewusstheit’ zum Bindeglied zwischen dem überzeitlichen Bestand des Logischen und seiner zeitlichen Tatsächlichkeit und damit zum Ausdruck des unbedingten Bedürfnisses, zu wissen.[14] Da sich dieses Bedürfnis auf Bestimmtes jedoch nicht stützen kann, ohne es zugleich in ein Problem zu verwandeln, treibt es das „‚jedesmalige’ Bewusstsein, d.h. […] das jedesmalige Subjekt im jedes Mal in Betracht gezogenen Erlebnisakt“ [3. S. 61] sowohl vorwärts wie rückwärts „unaufhaltsam […] bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können“ [2. B, S. 21].
Natorp zeichnet das unbedingte Bedürfnis, zu wissen, als ‚Streben’ und dieses ‚Streben’ als die umkehrbare Bewegung von etwas weg auf etwas hin aus[15]: Seine Plusrichtung drängt das jedesmalige sich zum Denken der Erkenntnis bestimmende Bewusstsein vorwärts zur Konstruktion der Grundbegriffe gegenständlicher Erkenntnis. Der Weg führt hier von der Bewusstheit als dem letzten Unmittelbaren des Bewusstseins zu den Ideen, die sein Erkenntnisbedürfnis in der Einheit seines Wissens regulieren.[16] Die Umkehrung dieses Weges, sozusagen seine Minusrichtung, führt nicht zurück auf einen absoluten, sondern auf einen ‚bloß’ relativen Anfang. Dessen Bestimmungen sind aus der Geschichte der Begriffe zu rekonstruieren, in deren Zusammenhang sich ‚Bewusstheit’ als die Subjektivität des Verhältnisses „des Vorgestellten zum Vorstellenden, sofern es von ihm vorgestellt wird“ [14. S. 155], darstellt. Was ein absoluter Anfang sein könnte, verliert sich in der unbestimmbaren Weite des Gefühls ‚Ich’. Dieses Gefühl ist der „letzte Innengrund“ [5. S. 110] der Subjektivität, als solches aber nichts als innere Wahrnehmung[17], d.h. reine Befindlichkeit „vor und über aller abgrenzenden Gestaltung“ [5. S. 110]. Es belebt alle Arten der Gestaltung mit seiner Wärme und Unmittelbarkeit und erhält so, indem es „die verschiedenen Provinzen menschlicher Bildung unter sich in die engste Verbindung setzt, […] die unteilbare Einheit, die Individualität des menschlichen Wesens lebendig“ [5. S. 53]. Anders formuliert: Das Gefühl ist bedeutend, insofern das jedesmalige Bewusstsein nur mit Beziehung auf es sein Denken als alles bestimmende Funktion seiner Bestimmung ebenso zur Erkenntnis wie zum Ich erleben kann.[18]
Somit geht für Natorp die Objektivierung des Erkenntnisproblems Hand in Hand mit seiner Individualisierung. Die Rekonstruktion des subjektiven Anteils am Objektiven der Erkenntnis hebt das individuelle Wahrnehmungsereignis nicht auf, sondern nimmt es, wie es ist, und wendet sich ihrem Erlebnis, „unabhängig von etwas anderem, […] nicht unmittelbar Erlebtem“ [3. S. 59] zu. Das Erlebnis unabhängig von allem nicht unmittelbar Erlebtem aber ist das unmittelbare Gefühl, das aus sich selbst heraus zur Bestimmung drängt bzw. strebt. Was Cohen das ‚Empfindungsgefühl’[19] ist, ist Natorp das ‚Strebungsgefühl’[20]: das Gefühl des Erlebnisses dessen, dessen Verwirklichung erst in Aussicht steht.[21] Die Bestimmung des Gefühls ist die Empfindung, die Bestimmung der Empfindung die Wahrnehmung, die Bestimmung der Wahrnehmung die Vorstellung und die Bestimmung der Vorstellung schließlich der Begriff. Gleichwohl ist auf jeder Stufe seiner Bestimmung das Strebungsgefühl das gleiche und doch formiert es sich auf jeder Stufe neu als das ‚immer schon irgendwie’[22] wirksame Sollen, dessen Sinn „auf der äußersten Grenze derjenigen Logik [entspringt], welche das Sein in engerer Bedeutung, das Sein der Erfahrung, überhaupt erst aufstellt und unter oberste, schlechthin allgemeine Gesetze bringt“ [5. S. 56].
V
Mit der These, dass die Subjektivität des Erkennens aus der Konfrontation eines jeden Grundes mit der Frage seiner Grundlegung zu rekonstruieren ist, biegt Natorps Allgemeine Psychologie auf ihre Zielgerade ein: Sie setzt weder ein Subjekt, noch ein Objekt vor oder außer der Erkenntnis voraus, sondern denkt das unbedingte Bedürfnis, zu wissen, als den Logos der Psyche und diesen Logos als die Potenz, die sich ἐξαίφνης in einem (empirischen) Bewusstsein aktualisiert, da dieses Bewusstsein sich zur Erkenntnis, d.h. zur Bestimmung der unauflöslich wechselseitigen Beziehung von ‚Objektivem’ und ‚Subjektivem’ in der Erscheinung bestimmt.[23] Das Ich, das alle meine Vorstellungen begleiten können muss, ist nicht anders als durch dieses sein ‚Können’ bestimmbar: eben als die Potenz, deren Begriff „die Positivität der Möglichkeit und der Aufgabe (der Bestimmung) in sich [schließt]. Das noch nicht Bestimmte wird zum Bestimmbaren, zu Bestimmenden, zur Möglichkeit und Forderung eben der Bestimmung, welche dann die objektivierende Erkenntnis an ihr vollzieht“ [3. S. 78]. Es setzt das dem Denken der Erkenntnis Mögliche mit dem zu seiner Darstellung Notwendigen ins Verhältnis. Zugleich aber stellt das dem Denken Mögliche dem es aktualisierenden Bewusstsein sein Unvermögen vor Augen, die Bestimmung dieses Verhältnisses in irgendeinem Begriffssystem jemals zu einem definitiven Abschluss bringen zu können. Nicht die Aufgabe, Erkenntnis zu denken, ist folglich problematisch, sondern das faktische Bewusstsein, das sich ihr stellt. Seiner Faktizität nach ist es ein Gegenstand der Erfahrung, seiner funktionalen Bedeutung nach hingegen durch die allgemeinen Regeln des Verstandesgebrauchs, d.h. durch reines Denken bestimmt. Seine Funktion, Erkenntnis zu denken, ist objektiv, das Bewusstsein seiner Funktion hingegen ist subjektiv, faktisch im Sinne von ‚empirisch’. Über diese die prozessuale Selbstreferenz des sich zum Denken der Erkenntnis bestimmenden empirischen Bewusstseins von innen heraus bestimmende Dialektik[24] kommt und will Natorps Allgemeine Psychologie nicht hinaus. Ihr genügt die Einsicht, dass ihr Problem nicht nur nicht einfach und ein für alle Male gegeben ist, sondern sich vielfach und immer wieder neu in allen und für alle Richtungen des Bewusstseins stellt.
Genauer besehen, heißt das: Dem Problem der faktischen, d.h. individuellen Einheit des Bewusstseins in der Vielfalt seiner Richtungen ist mit der Bestimmung des Bewusstseins zum Fieri des Denkens nicht beizukommen. Die Logik als Lehre der reinen Verstandesfunktionen, bestimmt deren Fieri als das „Urgesetz der Methode“ [3. S. 183] zur Konzentration der regulativen Ideen im Denken der Natur, der Sittlichkeit, der Kunst und auch der Religion zur Einheit des Kulturbewusstseins. Sie wirft „zwar grelle und helle Streiflichter auf die Seele des Menschen […]; aber theoretische Einsicht in die Verschlungenheiten seines Wesens […] wird dadurch nicht erzielt“ [9. S. 22]. Das Wesen ‚Mensch’ ist so wenig gegeben wie das Kulturbewusstsein, mit dessen Begriff Natorp die Aufgabe verbindet, die Person als die jederzeit empirische Einheit, die zu sich Ich zu sagen weiß, reflexiv, d.h. als das Subjekt der Kritik des Denkens der Natur, der Sittlichkeit, der Kunst und der Religion zur Geltung zu bringen. Im Focus des theoretischen Interesses an der Psychologie als Wissenschaft steht für Natorp daher die Frage: wie das ‚Ich denke’ als der Akt, mein Dasein zu bestimmen[25], allgemein darstellbar und begreiflich werde. Die Psychologie selbst bleibt und muss die Antwort auf diese Frage schuldig bleiben. Denn im Akt der Bestimmung seines Daseins unterwirft das sich zum Denken der Erkenntnis bestimmende (empirische) Bewusstsein einem Sollen, dessen Bestimmung wiederum nur eine Frage der Erkenntnis sein kann. Deren grundlegende Bedeutung zu vertreten, ist, jedenfalls Natorp zufolge, Aufgabe der Ethik. Die grundlegende Bedeutung der Ethik zu vertreten, wiederum bedeutet ihm letzte Aufgabe der Philosophie.[26]
1 Vgl. [4. S. 276]: „Denken […] ist nichts anderes als Setzen von Relation.“
2 Vgl. [6. S. 334].
3 Vgl. [7. S. 271].
4 Vgl. [8. S. 148f., 190].
5 Vgl. [9. S. 423f.].
6 Vgl. [9. S. 469 f.].
7 Der ‚Anfang‘ ist „Setzung gleichsam […] voraus aller Bestimmtheit, um für alle offen zu sein“ [10. S. 229].
8 Vgl. [3. S. 123f.].
9 Vgl. [4. S. 94].
10 Vgl. [3. S. 193]: „Etwas, ein Gegenstand, erscheint mir, und: Ich habe davon ein Bewusstsein, dies ist in der Sache eins.“
11 Vgl. [4. S. 35; 3. S. 261].
12 Vgl. [3. S. 21].
13 Vgl. [4. S. 29].
14 Vgl. [3. S. 68; 5. S. 22, 27].
15 Vgl. [12. S. 25; 13. S. 63].
16 Vgl. [3. S. 78, 80f., 201]. Die Ideen sind Exponenten der Beziehung der subjektiven, auf vielerlei Weise bestimmbaren Vorstellung auf die Form des Bewusstseins, in der sie etwas Bestimmtes bedeutet.
17 Vgl. [6. S. 334].
18 Vgl. [3. S. 214].
19 Vgl. [15. S. 156]: Das ‚Empfindungsgefühl‘ bildet als „erste Anlage zum Bewusstsein […] die Grundlage unserer Psychologie.“ Die Empfindung tritt an die zweite Stelle: „Sie hat zur Voraussetzung jene erste Stufe der allgemeinen Anlage, des notwendigen Vorbegriffs, des Ursprungs“ [15. S. 156].
20 Vgl. [13. S. 63].
21 Vgl. [13. S. 60f].
22 Vgl. [14. S. 156].
23 Vgl. [3. S. 80; 5. S. 47]: der Urakt des Denkens ist Akt der Bestimmung.
24 ‚Dialektik‘ im Sinne des Platonischen ‚διαλέγεσθαι‘: als schlechthin fundamentale Grundwissenschaft der Methode „einen Gedanken von der Frage nicht zur abschließenden Antwort, sondern zu nur immer radikaleren Fragen“ zu entwickeln. Die Dialektik öffnet den Weg des Fragens, „zur unbegrenzten Vertiefung des Problems“ [4. S. 16].
25 Vgl. [2. B, S. 157], Anm.
26 Vgl. [3. S. 22].
Об авторах
Томас Кноппе
Автор, ответственный за переписку.
Email: thomas.knoppe@posteo.de
доктор философии, независимый исследователь Германия, 41542, Дормаген, Илтисвег, д. 27
Список литературы
- Kant I. Logik. Physische Geographie, Pädagogik. In: Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken. Bd. 9. Available from: https://korpora.org/Kant/aa09/ (accessed: 01.09.2024).
- Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Leipzig: F. Meiner; 1919.
- Natorp P. Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Luft S, hrsg. kommentiert und mit einer Einleitung versehen. Darmstadt; 2013.
- Natorp P. Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. Leipzig; 1910.
- Natorp P. Philosophie - ihr Problem und ihre Probleme. Eine Einführung in den kritischen Idealismus. Lembeck, K-H, hrsg. und mit einer Einleitung. 5. Aufl. Göttingen; 2008.
- Kant I. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. In: Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken. Bd. 4. Available from: https://korpora.org/Kant/aa04/ (accessed: 01.09.2024).
- Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. Edel G, Mit einer Einleitung. 5. Aufl. Hildesheim, Zürich, New York; 1987.
- Edel G. Von der Vernunftkritik zur Erkenntnislogik. Die Entwicklung der theoretischen Philosophie Hermann Cohens. Freiburg, München; 1986.
- Cohen H. Logik der reinen Erkenntnis. Holzhey H, Mit einer Einleitung. 4. Aufl. Hildesheim, New York; 1977.
- Natorp P. Allgemeine Logik. In: Flach W, Holzhey H. Erkenntnistheorie und Logik im Neukantianismus: eine Textauswahl. Hildesheim; 1979. S. 227-269.
- Natorp P. Sozialpädagogik. Theorie der Willensbildung auf der Grundlage der Gemeinschaft. 7. Aufl.; Pippert R, besorgt. Paderborn; 1974.
- Natorp P. Allgemeine Psychologie in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen. 2. Aufl. Marburg; 1910.
- Natorp P. Philosophische Propädeutik. (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen. 2. Aufl. Marburg; 1905.
- Natorp P. Über objektive und subjektive Begründung der Erkenntnis. In: Flach W, Holzhey H. Erkenntnistheorie und Logik im Neukantianismus: eine Textauswahl. Hildesheim; 1979. S. 139-168.
- Cohen H. Ethik des reinen Willens. Schwarzschild StS, Mit einer Einleitung. 5. Aufl. Hildesheim, New York; 1981.
Дополнительные файлы