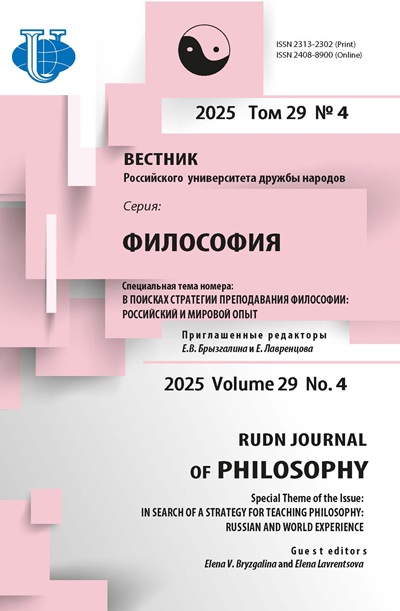Epistemological Problems of Quantum Mechanics Following Ernst Cassirer and Richard Hönigswald
- Authors: Breil R.1
-
Affiliations:
- RWTH Aachen University
- Issue: Vol 28, No 3 (2024): POST-NEO-KANTIANISM
- Pages: 670-687
- Section: POST-NEO-KANTIANISM
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/40983
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-3-670-687
- EDN: https://elibrary.ru/YKJGEK
- ID: 40983
Cite item
Full Text
Abstract
This article deals with the Copenhagen interpretation of quantum mechanics and its epistemological discussion by Ernst Cassirer and Richard Hönigswald. The starting point is Cassirer's treatise Determinism and Indeterminism in Modern Physics, published in Stockholm. Both philosophers and several physicists were involved in the subsequent exchange of letters. From a physical point of view, the Copenhagen interpretation was particularly criticised by v. Laue and Einstein. Both demanded a revision of the foundations of quantum mechanics or a critical examination of essential physical concepts. The epistemological implications of the Copenhagen interpretation were rejected, in particular that the interactions between observation, the observed and the observer in quantum physics experiments should lead to a renunciation of the concept of causality or an objectively unambiguous description of natural processes. Cassirer argues here that quantum mechanics fulfils the epistemological requirement of transforming ontological “concepts of things” into epistemological concepts of relations and is therefore compatible with the neo-critical approach he advocates. At the same time, Hönigswald was working on two major treatises on the structure of physics and the concept of causality. Here he undertakes an epistemological foundation of physics as a whole. A transcendental foundation of the concept of experience and its specifications in principles such as contemplation, observation or experiment appears to be called for. Hönigswald therefore essentially rejects the Copenhagen interpretation, as it draws epistemological consequences by physical means and thus inadmissibly reverses the transcendentally necessary relations of justification. These arguments are examined and could be used for a current discussion on the epistemological foundations of quantum mechanics and physics as a whole. A post-Neo-Kantian, transcendental philosophical foundation of scientific knowledge, especially of modern physics, seems possible and necessary.
Full Text
Zur Problemlage um 1930
Anfang der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts konvergierten zwei Entwicklungen innerhalb der Physik und des Neukantianismus, die auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten besaßen. In der Physik waren inzwischen zwei moderne Theorien etabliert, die es geboten ließen, fortan von einer modernen Physik im Unterschied zur klassischen Physik zu sprechen. Die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie etablierten sich im Laufe der frühen zwanziger Jahre. Die Quantentheorie gelangte nach mehreren Jahrzehnten der theoretischen und experimentellen Entwicklung mit Johann von Neumanns berühmter Darstellung [1] zu einem vorläufigen Abschluss ihrer theoretischen Ausgestaltung. Gelöst waren zwar die Probleme des mathematisch-physikalischen Mechanismus, nicht aber, wie die experimentellen quantentheoretischen Resultate zu interpretieren wären und ob quantenmechanische Messprozesse realistische Aussagen über das Quantenobjekt selbst zulassen. Es etablierte sich unter dem maßgeblichen Einfluss Bohrs und Heisenbergs die „Kopenhagener Deutung“.
Die Kopenhagener Deutung behauptet den Welle-Teilchen-Dualismus der Materie als einen irreduziblen Grundzug der Natur insgesamt, mindestens aber ihrer physikalischen Beschreibung. Demnach beziehen sich quantenmechanische Aussagen auf individuelle Systeme, für die die Schrödingergleichung die bestmögliche Kenntnis des Systemzustandes ermöglicht. Die Messapparaturen unterliegen dabei den Bedingungen der klassischen Physik. Diese müssen notwendigerweise herangezogen werden, um überhaupt quantenphysikalische Sachverhalte beobachten und messen zu können. Dazu entwickelt Bohr das Prinzip der Komplementarität. Wenn Vorgänge in Raum und Zeit beschrieben werden – und das ist die Grundlage der klassischen Physik – erfordern sie Messungen von beobachtbaren Größen. Doch diese Beobachtungen bedingen auf atomarer Ebene quantenmechanische Störungen der beobachteten Objekte, die unkontrollierbar sind. Deterministische Erklärungen sind da unmöglich, wo Beeobachtungsgrößen in Größenordnung der Planck-Konstante h liegen. Hier schließen sich also eine klassische, raum-zeitliche und eine gleichzeitige deterministische Beschreibung eines Vorgangs aus. Die Gesamtheit aller Phänomene erschließt sich daher nur in komplementären, verschiedenen theoretischen Beschreibungen. Nach der Deutung Heisenbergs sind reale physikalische Eigenschaften nur als Zusammenhang von Messergebnissen gegeben, die den Einschränkungen der Unschärferelationen unterliegen, woraus folgt, dass isolierte, „unbeobachtete“ Quantensysteme keinen objektiven Zustand besitzen [2. S. 16–23].
In der Folge kam es innerhalb der Physik zu kritischen Fragen nach der „Vollständigkeit“ der Quantenmechanik und der damit verbundenen Suche nach einer begrifflich einheitlichen Beschreibung physikalischer Vorgänge. Diese Diskussion reicht bis in die Gegenwart und ist geprägt durch die Suche nach einem befriedigenden Verständnis des quantentheoretischen Messprozesses [2]. Wichtig werden zunehmend auch technische Anwendungen, die von Chemie und Medizin bis hin zur Entwicklung von Quantencomputern reichen. Ihnen liegt die Auffassung zugrunde, dass die quantenmechanische Realität nicht-lokal ist [3. S. 1–9].
Während die Physik am Beginn des 20. Jahrhunderts vor einer neuen theoretischen und experimentellen Entwicklung stand, begann der Niedergang des Neukantianismus. Zudem wandelte sich der Neukantianismus insgesamt in den zwanziger Jahren zu einer allgemeinen Kulturphilosophie. Bezüglich der Physik und ihrer modernen Entwicklung waren noch immer die früheren Arbeiten Natorps und Cassirers wegweisend. Beide vertraten eine strikte Trennung transzendentallogischer Grundlegung einerseits und empirischer Naturwissenschaft andererseits. In diesem Sinne bestimmt Cassirer die Physik als eine reine Gesetzeswissenschaft, in der es ausschließlich auf die Entdeckung von Gesetzen, messbaren Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen ankomme. Das Verhältnis von Transzendentalphilosophie und Physik wird als ein Bedingungsverhältnis begriffen, in dem sich Kategorialbegriffe in konkreten Anwendungen spezifizieren [4. S. 72]. Doch diese Trennung von kategorialer Prinzipientheorie der Erfahrung einerseits und empirischer Naturwissenschaft andererseits ließ sich angesichts der erkenntnistheoretischen Fragen, die z. B. mit dem Welle-Teilchen-Dualismus verbunden sind, nicht länger aufrechterhalten.
Unbeachtet blieb leider der wissenschaftstheoretische Diskurs, der in den dreißiger Jahren trotz der bedrückenden Umstände des Nationalsozialismus geführt wurde. Vor allem Cassirer und Hönigswald waren in den dreißiger Jahren diejenigen, die von kritizistischer Seite aus erkenntnistheoretische Probleme der Quantenmechanik diskutierten. Während Cassirers Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik noch 1937 in Göteborg erschien [5], konnten zwei wichtige wissenschaftstheoretische Arbeiten Hönigswalds zu Problemen der modernen Physik erst nach dem Krieg in den unter der Leitung von Hans Wagner herausgegebenen nachgelassenen Schriften publiziert werden. Ausgearbeitet lagen sie in den späten dreißiger und in den vierziger Jahren für den Druck vorbereitet vor [6]. Zu den mit der Quantenmechanik verbundenen erkenntnistheoretischen Fragen trat vor allem der bekannte Physiker Max von Laue in einen Austausch mit Cassirer und Hönigswald. Zu Cassirer hat von Laue auch über 1933 hinaus die Kontakte gehalten und noch 1933 gegen Widerstände den Druck von Hönigswalds wichtigem Text Kausalität und Physik [7] veranlasst. Hönigswald selbst stand bis zu seiner Emigration 1939 in München vermutlich auch im wissenschaftlichen und privaten Austausch mit dem bekannten Physiker Arnold Sommerfeld, wie ein Brief Hönigswalds an Cassirer nahelegt [8].
Cassirer: Kausalität und moderne Physik
Auf der Grundlage der Kopenhagener Deutung legte Ernst Cassirer 1937 seine in Göteborg im Exil erschienene Studie Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik vor, als Grundlage für ein gemeinsames Forschungsprogramm von kritizistischer Erkenntnistheorie und Physik [5. S. 5]. Cassirers Vorschlag zur Auflösung der mit der Kopenhagener Deutung aufgeworfenen erkenntnistheoretischen Probleme hält an der kritizistischen Position fest, die apriorischen Grundlagen der Erfahrung seien zugleich die Bedingungen der wissenschaftlichen Erfahrung. Kategorien wie Raum, Zeit und Kausalität sind die Prinzipien, die Erfahrung ermöglichen und daher auch die transzendentalen Bedingungen einer konkreten Naturwissenschaft wie der Physik. Die Kausalität oder Nicht-Kausalität der Natur beispielsweise kann deshalb nicht aus der Erfahrung gewonnen oder durch Erfahrung widerlegt werden, weil jedes Datum bereits ein kausal bestimmtes wäre. Wie bereits in Substanzbegriff und Funktionsbegriff sollen die ausführlichen historischen Exkurse den Gedanken begründen, die Geschichte der Physik sei ein Prozess, der durch fortschreitende Auflösung von „Tatsachen in Symbole“ bestimmt sei [9. S. 160]. Dieser Gedanke, der ursprünglich auf die klassische Physik bezogen war, wird nun auch auf die Bedingungen der modernen Physik übertragen.
Dazu wird in einem weiteren Schritt das theoretische Gefüge der Physik als ein System von Objektivitätsstufen aufgefasst [10. S. 81–93]. Unterschieden wird nun zwischen individuellen Maßaussagen, generellen Gesetzesaussagen und universellen Prinzipien, die sich faktisch in der physikalischen Forschung gegenseitig bedingen und stützen [5] (67f) Maßaussagen setzen zunächst das empirisch gegebene als physikalisch Gegebenes in quantitative Bestimmungen nach Maß und Zahl um, z. B. die Strecke von A nach B beträgt 43,8 km – die Physik ist eben eine „messende“ Wissenschaft. Aus Messergebnissen werden allgemeine mathematisch formalisierte Gesetze von verschiedener Allgemeinheit erzeugt, die das „Hier und Jetzt“ der Maßaussagen in eine „neue Dimension“ [5] (52f) überführen: Gesetze bleiben nicht in räumlich-zeitlicher Bestimmtheit, sondern heben diese auf, indem sie für alle möglichen unter das Gesetz fallende Ereignisse gelten. Es ist eben unsinnig zu fragen, ob die Maxwell-Gleichungen „immer“ für elektromagnetische Phänomene gelten. Dieses Zusammenfassen von „beobachteten Tatsachen zu Gesetzen“ [5] (57ff) führt wiederum zu Prinzipienaussagen, zu denen Cassirer beispielsweise das Prinzip der kleinsten Wirkung zählt. Diese Prinzipien haben eine forschungsleitende Funktion, indem ihre Anwendung unter anderem dem Auffinden weiterer Gesetze dient und es zugleich ermöglichen, verschiedene Gesetze zu allgemeinen Theorien zusammenzuführen. Auch kategoriale Prinzipien wie die Kausalität werden als Prinzipien aufgefasst, allerdings als forschungsleitende regulative Prinzipien, die methodisch die Suche nach immer allgemeineren Gesetzen leiten und nicht aus der Erfahrung gewonnen werden könnten. In diesem Sinne sei das Kausalgesetz ein transzendentales, ein Erfahrung ermöglichendes Prinzip [5. S. 77].
Cassirers Position zur Kopenhagener Deutung der Quantentheorie fällt daher überwiegend affirmativ aus. Die Physik habe es eben primär nicht mit „Dingen“, mit sinnlich-anschaulichen Vorstellungen, sondern mit gesetzlichen Zusammenhängen zu tun. In den neuen gesetzlichen Relationen verlieren „Dinge“, „Substanzen“ – physikalisch interpretiert als Masseteilchen – ihren Sinn. In der Quantenmechanik tritt ein neuer Gesetzestypus neben und an die Stelle der klassischen Gesetze. Das bedeutet eben, dass stetige dem Begriff, durch das Prinzip diskreter Quantenzustände ersetzt werden. Doch auch diese unterliegen prinzipiell den Bedingungen der Messbarkeit und daher gilt das Kausalprinzip als transzendentale Bedingung jeder möglichen physikalischen Erfahrung auch hier; andernfalls wäre eine messende Physik der Quantenphänomene unmöglich [5. S. 214] Das „Kausalgesetz der Quantenmechanik“ bedeute, „daß es, wenn zu irgendeiner Zeit gewisse physikalische Größen so genau gemessen werden, wie dies prinzipiell möglich ist, auch zu jeder anderen Zeit Größen gibt, für die das Resultat einer Messung präzis vorhergesagt werden kann“ [5] (225f). Also scheint sich das Kausalitätsprinzip in der Anwendung zu erschöpfen, strenge Gesetze aufzustellen und diese so in mathematischer Sprache zu formulieren, das aus ihnen eindeutig bestimmt werden könne, was unter gegebenen experimentellen Bedingungen zu messen wäre. Daher stellen die Unschärferelationen „keine kategorialen Aussagen über das objektiv-Wirkliche“, sondern „modale Aussagen über das empirisch Mögliche, über das physikalisch-Konstatierbare“ dar [5. S. 232].
Das aber ist die Position der Kopenhagener Deutung. Erkauft ist diese Annäherung mit der Aufgabe der Bearbeitung wesentlicher Problembestände. Das geringste der damit verbundenen Probleme ist die Umdeutung der Kausalitätskategorie, die Kant als ein objektiv-objektiv-konstitutives Prinzip von Erfahrung überhaupt gedacht hat und Cassirer als ein bloß regulatives Prinzip physikalischer Methodik umdeutet. Die Konsequenz ist die Annahme, die Physik als Paradigma wissenschaftlicher Naturerkenntnis falle mit den kategorialen Bedingungen der Konstitution von Erfahrung überhaupt zusammen. Damit liefert Cassirer wesentliche Fragen der Erkenntnistheorie den empirischen Bedingungen physikalischer Forschung aus: Was es bedeutet, was unter einem Zustand zu verstehen sei, welche methodische Funktion Messung und Beobachtung für die Physik bedeuten, wie Einheit der Natur als Idee gedacht werden muss, sind Fragen, die innerhalb der Physik selbst zu klären sind. Folglich sind die Probleme der Kopenhagener Deutung zugleich die Probleme der kritizistischen Position Cassirers.
Ein Briefwechsel zur Quantenmechanik von 1937
Deutlich wird dies aus einem Briefwechsel, dessen Anlass einige Exemplare seiner neuen Studie zur modernen Physik waren, die Cassirer offenbar aus dem schwedischen Exil auch an bekannte Physiker verschickt hat. Die meisten, wie Heisenberg [11], danken höflich für den Erhalt. Nur wenige treten in eine sachliche Auseinandersetzung ein. Einstein etwa trägt seine eigenen bekannten Bedenken über die vorgebliche Unvollständigkeit der Quantenmechanik vor [12]. Auffallend ist die abweisende Antwort Erwin Schrödingers, der Cassirers erkenntnistheoretische Analysen mit der Bemerkung ablehnt, dass diese nichts zur Klärung der gegenwärtigen Lage der Physik beitragen könnten, was Physiker nicht selbst leisten könnten [13]. Max Born, der 1933 nach Großbritannien emigrieren musste, ist die anerkannte statistische Interpretation der Wellenfunktion zu verdanken. Er äußert sich ausführlich und grundsätzlich zustimmend, insbesondere zu Cassirers These, die Physik begreife das in der Physik Gegebene als durch Funktionsbegriffe bestimmte Invarianten. Es komme auf Gesetzlichkeit überhaupt, nicht auf die besondere mathematische Form der Gesetze an. Kritisch sieht er dagegen den Versuch, die Grundsätzlichkeit des Welle-Teilchen-Dualismus durch Verzicht auf den Begriff des Massepunktes als physikalisches Substrat der Teilchenvorstellung aufzuheben, den Cassirer als ein entbehrliches Relikt der klassischen Physik zu betrachten scheint [14]. Born als einer der Hauptverfechter der Kopenhagener Deutung hält den vermeintlichen Indeterminismus der Quantenmechanik und den komplementären Deutungsansatz für fundamental. Cassirers weitere Analysen, wenn sie auf Versöhnung dieser Gegensätze zwischen klassischer und moderner Gesetzlichkeiten und Begriffe abzielen, lehnt Born daher ab.
Ausführlich antwortet auch Max von Laue in zwei Briefen, der selbst der Kopenhagener Deutung eher kritisch gegenüber steht. Bezüglich der methodischen Bedeutung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs ist von Laue im Unterschied zu Cassirer der Meinung, dass es „absichtlich unvollständige Naturerkenntnis“ auch in der klassischen Physik gibt. Ein Beispiel ist die kinetische Gastheorie, in der ein Physik nicht das Verhalten eines einzelnen Gasatoms beschreiben will, sondern das Gesamtsystem. Kausalität und Wahrscheinlichkeit schließen sich nicht notwendigerweise aus, sondern hängen von der zugrundeliegenden physikalischen Problemstellung ab. Mit diesem Argument bezweifelt von Laue Cassirers Behauptung, der Wahrscheinlichkeitsbegriff beziehe sich hier auf die unvollständige Kenntnis der Anfangsbedingungen der Newtonschen Bewegungsgleichungen, die Kausalität aber auf die Kenntnis des Ablaufs des Geschehens. Der erkenntnistheoretischen Untersuchungen grundsätzlich aufgeschlossene von Laue weist zudem auf das Kernproblem hin: Cassirer glaubt, Kants Kategorienlehre als Grundlagentheorie der wissenschaftlichen Erfahrung den Erfordernissen und Fortschritten der modernen Physik entsprechend „umbilden“ zu müssen. Aber eine „richtige Erkenntnistheorie“ muss doch invariant gegenüber allen Veränderungen sein, die die Physik im Laufe ihrer Geschichte macht [15]. Später verschärft von Laue diesen Gedanken: Wenn sich im Prinzip der Komplementarität räumlich-zeitliche Darstellung und Kausalität einander ergänzen, aber ausschließen, ist dies unvereinbar mit Kants Erkenntnistheorie, da doch die Kausalität gerade die Objektivität raum-zeitlichen Geschehens ermöglicht. Naturerkenntnis und Naturgegenstände seien zu unterscheiden und Cassirers Neigung, physikalische Theorie und Gegenstand auf dieselben kategorialen Prinzipien zu gründen, erscheinen im Licht dieser Einwände zweifelhaft. Über den erkenntnistheoretischen Zustand der Quantenmechanik urteilt von Laue ebenfalls kritisch. In seiner Kritik nimmt er um Jahrzehnte vorweg, wohin es zur Kopenhagener Deutung alternative Konzeptionen nach dem Krieg schließlich treibt: Entweder ist die Quantenmechanik unvollständig und bedürfe daher eines deterministischen Unterbaus, oder sie ist vollständig, dann aber ist eine Revision der von ihr verwendeten klassischen Begriffe wie Ort und Impuls eines Körpers notwendig. Die dritte Möglichkeit schließlich ist die damalige Position von Laues: Wegen der notwendigen „Eliminierung der anstößigen Begriffe“ bedürfe die Quantenmechanik einer „gründlichen“ Umgestaltung ([16] Vgl. auch [5. S. 139]).
Max von Laues Kritik an der Kopenhagener Deutung
Dies begründet von Laue mit dem Versuch, die Quantenmechanik im Gegensatz zur Kopenhagener Deutung in die Kontinuität der physikalischen Methodik und Wissenschaftsentwicklung zu rücken. Nicht nur die Quantenmechanik, auch die klassische Physik enthält wie alle physikalischen Theorien hypothetische Elemente, die über die zugrundeliegende Erfahrung hinausgehen [17. S. 915]. Sie unterliegen damit der prinzipiellen Revision durch die empirische Forschung. Als Beispiele nennt von Laue den Trägheitssatz und den Begriff des Körpers, der durch den Begriff des Massepunktes bestimmt wird. Beide enthalten Annahmen, die der experimentellen Forschung zugrunde gelegt werden. Dass der Begriff des Massepunktes eine mathematisch motivierte Idealisierung von Materieteilchen darstellt, ist relativ leicht zu sehen. Selbst Elementarteilchen und Atome haben in der klassischen Teilchenvorstellung eine zwar geringe, aber dennoch vorhandene räumliche Ausdehnung. Galileis Trägheitsprinzip dagegen fungiert als Prinzip solcher Idealisierung, denn auf ihm beruht die Möglichkeit der Physik als mathematische Naturwissenschaft. Die kräftefreie, mit konstanter Geschwindigkeit erfolgende Bewegung eines Massepunkts setzt nach von Laue nämlich voraus, dass dieser mathematisch eine stetige, geradlinige Bahn beschreibt. Bei bekannter Anfangsgeschwindigkeit und bekanntem Kraftgesetz ist auch jede andere beliebige Bahnkurve durch Anfangsort und Anfangsimpuls zu jedem weiteren Zeitpunkt bestimmt und bei bekannten Anfangsparametern berechenbar. Die Aufgabe nur einer der beiden Annahmen führt zu einem „Zusammenbrechen des Ganzen“ [17] der klassischen Physik, da physikalische Begriffe und Prinzipien theoretisch zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen.
Heisenbergs Unbestimmtheitsrelationen stellen diese klassischen Voraussetzungen aufgrund experimenteller Tatsachen in Frage und sind daher Teil eines methodisch normalen Prozesses der Theorieentwicklung. So ist auch das Problem beschaffen, vor dem die moderne Physik steht. Es besteht darin, dass jetzt Wellenvorgänge mit der Bewegung von Körpern verknüpft sind, was zu der neuen Annahme eines allgemeinen Welle-Teilchen-Dualismus führt. Allerdings sei mit diesem Dualismus das sogenannte „Quantenrätsel“ verbunden, denn die Frage, „was ein Körper sei“, müsse auch die Quantenmechanik beantworten, weil die Unbestimmtheitsrelationen Begriffe der klassischen Physik – Ort und Impuls – voraussetzen, die wiederum auf dem Begriff des Massepunktes beruhen. Daher versagen neueren Erfahrungen gegenüber bestimmte, „auf Erfahrung gegründete physikalische Begriffe“, während bessere Begriffe fehlen [17].
Auch die erkenntnistheoretischen Implikationen der Kopenhagener Deutung sind zurückzuweisen. Diese betreffen die Geltung des Kausalitätsprinzips, die Anwendbarkeit physikalischer Begriffe und das Problem physikalischer Messungen insgesamt. Aus den Ungenauigkeitsbeziehungen folgt keineswegs zwingend der Schluss auf ein Versagen des Kausalitätsprinzips, „weil man bei ihnen Begriffsbildungen verwendet, die aus Newtons Mechanik stammen und gleich dieser Mechanik empirischen Ursprungs sind“ [18. S. 439]. Daraus folgt nur, dass diese klassischen Begriffe auf atomare Vorgänge nicht anwendbar sind. Der statistische Grundzug der Quantenmechanik setzt daher die Geltung des Kausalitätsprinzips nicht außer Kraft. Noch niemals habe die Physik die Geltung des Kausalitätsprinzips empirisch bewiesen, sondern stets methodisch vorausgesetzt. Auch wenn ein kausales Verständnis atomarer Vorgänge an der prinzipiellen Messbarkeitsgrenze scheitere, weil diese Messungen „kleinere Gebilde“ benötige, die man deshalb nicht benutzen kann, weil es sie nicht gibt bzw. sie den Messvorgang stören, liege hier grundsätzlich keine „unübersteigbare Grenze der Erkenntnis“ vor. Wenn zudem die begriffliche Grundlage der Quantenmechanik teilweise noch unklar sei, verbiete es sich um so mehr, aus dem gegenwärtigen Zustand der Physik weitreichende erkenntnistheoretische Schlüsse zu ziehen. So lassen die experimentellen Resultate zur Elektronenbeugung oder die wellenmechanische Deutung der Linienspektren nur den Schluss zu, dass die alte Teilchenvorstellung der Materie unrichtig ist, da sie diesen experimentellen Ergebnissen widerspricht. Ein letzter psychologischer Gesichtspunkt wird abschließend noch herangezogen: Was man als anschaulich bezeichnet, ist auch in der Physik zeitbedingt; Unanschaulichkeit folgt „für die Zeitgenossen“ aus einer empirisch erzwungenen Änderung von Theorien. So setzen die Unschärferelationen nur „jeder korpuskularen Mechanik eine Grenze, nicht aber jeder physikalischen Erkenntnis“ [18. S. 440].
Grundsätzlich weiter in Deutungsfragen der Quantenmechanik ist man auch heute nicht; die experimentellen Resultate werden zwar immer umfangreicher, aber das begriffliche Verständnis arbeitet sich noch immer am Welle-Teilchen-Dualismus ab. Erkenntnistheoretische Untersuchungen zur Physik müssen diesen daher anerkennen und zeigen, inwiefern eine Theorie der Erfahrung allgemein mit der Möglichkeit der Quantenmechanik im Besonderen nicht nur vereinbar, sondern als deren Grundlage möglich ist. Das ist das Programm der Theorie Hönigswalds, die teilweise unter dem Einfluss von Laues entstanden ist.
Hönigswald: Zum Begriff der Physik
Denn auch Hönigswald sieht die Schwierigkeiten in Cassirers neukantianisch geprägten Erfahrungsbegriff. Vorsichtig bringt er, zunächst Cassirer zustimmend, das Argument in die Diskussion, die „Identität des Gegenstandes“ bleibe auch in der Quantentheorie erhalten, indem zunächst der dort verwendete Ensemble-Begriff (er spricht von Systemen und Kollektiven) an die Stelle von diskreten Gegenständen trete und auch der Begriff diskreter Zustände ein invariantes Zuordnungsprinzip fordert. Ein weiterer Gesichtspunkt betrifft das Problem der Messung und dem damit verbundenen Problem der „Rückbeziehung“ mikroskopischer Erfahrung auf elementare Alltagserfahrung, denn auch die unanschaulichste physikalische Theorie bleibe als physikalische Theorie an die „Idee sinnlicher Gegebenheit“ gebunden. Erfahrung so Hönigswald ist daher ein Inbegriff theoretisch-kategorialer und sinnlich-anschaulicher Relationen [8].
Hönigswalds allgemeine Grundlegung der Physik setzt aber nicht die Konstitution naturwissenschaftlicher Erkenntnis mit den Bedingungen allgemeiner Erfahrung gleich. Unterschieden wird im Anschluss an Kant zwischen Anschauung und Begriff bzw. zwischen Anschauung und Theorie, die sich in transzendentaler Relation gegenseitig bestimmen. Zugleich weist Hönigswald die transzendentalen Bedingungen der Erfahrung als Prinzipienbestände der Subjektivität aus. Dass Anschauung möglich ist, liegt an den natürlichen Bedingungen erlebender Organismen, der Empfindung; hier verwendet Hönigswald den entsprechenden Terminus Kants. Anschauung in dieser Tatsächlichkeit kann einerseits selbst Gegenstand möglicher Erfahrung und Naturwissenschaft sein. Andererseits ist der Organismus erkennender Subjekte zugleich ein Prinzip, das Erfahrung über seine Anschauungsbezüge ermöglicht. So sind auch Raum und Zeit auf eine letztdefinierte monadische Instanz, das Prinzip der Präsenz, verwiesen. Alles Gegebene ist zwar als Tatsache in der Zeit, immer aber prinzipienhaft „auf einmal“ gegeben [6. S. 121]. Präsenz bedeutet hier die gestaltete Zeit eines Subjekts. Gegebenes, das zugleich Tatsache und Prinzip ist, nennt Hönigswald monadisch bestimmt. Daher ist die Erfahrungstatsache gegeben, da sie erlebbar ist, und das heißt, dass sie für „jeden“ erlebbar ist und die Bedingungen der Intersubjektivität erfüllt.
Naturwissenschaftliche Erkenntnis erscheint so als ein besonderer Typus methodenbestimmter Erfahrungserkenntnis. Die Relation von Anschauung und Begriff spezifiziert sich in der physikalischen Naturwissenschaft in methodenbestimmte Anschauung, in Beobachtung, Messung und Experiment, und in physikalische Begriffe und Theorie. Schlüsselbegriffe der Grundlegung der Naturwissenschaft wie Experiment und Beobachtung leisten zunächst die jeder wissenschaftlichen Bestimmung vorhergehende Anbindung des Erfahrungsgegenstandes an das Subjekt. Sinnlich Gegebenes unterliegt in dieser Hinsicht den Bedingungen des Organismus, indem es dem Subjekt immer nur als Reiz gegeben ist. Umgekehrt bestimmen sie die Richtungsbezogenheit des kategorialen Ordnungsgefüges auf den Erfahrungsgegenstand. Daher sind physikalische Gegenstände extensiv-größenbestimmt und darum auch geometrisch-mathematisch bestimmbar. Das Verhältnis von empirischer Einzeltatsache und Naturgesetz muss als eine vom experimentierenden Beobachter unabhängige Beziehung gedacht werden, die sich an einer Einzeltatsache nachweisen lässt und auf Tatsachen bezogen bleibt. Naturgesetze können deshalb nie unabhängig von empirischen Befunden entdeckt werden, sondern bedürfen der Erfahrung. So ist jedes Experiment als Instrument der naturwissenschaftlichen Forschung das Produkt naturwissenschaftlicher Methode und steht unter den Gesichtspunkten der Theorie. Gleiches gilt für die methodische Funktion von Messung und Beobachtung im Experiment. Auch hier geht es nicht um technische Probleme von Messung und Beobachtung, die natürlich den durch Quantentheorie und Relativitätstheorie bestimmten Bedingungen unterliegen. So verkörpert auch das physikalische Prinzip der Messung den Wechselbezug von Theorie und Anschauung im Erfahrungsbegriff. An ihm bestimmt sich die extensive, raum-zeitliche Größenbestimmtheit der Erscheinungen und damit auch die mögliche Anwendbarkeit der Mathematik auf Naturgegenstände. Die Messung bedarf ebenso theoriegeleiteter Überlegungen in ihrer Anwendung auf zu messende Naturgegenstände, wie sie umgekehrt die naturwissenschaftliche Theoriebildung notwendig in ihrer Anwendung auf Naturgegenstände nachprüft und leitet. Beobachtung und Messung sind deshalb Grundfunktionen des Experiments [6] (32 ff).
Daraus sind die Konsequenzen für die mit der Geltung der Quantenmechanik verbundenen erkenntnistheoretischen Probleme zu ziehen. Zunächst lehnt Hönigswald Heisenbergs Deutung des Messproblems ab, insbesondere die Behauptung, dass keine vom Beobachter unabhängige objektive physikalische Realität zugänglich sei, da durch den Beobachter bzw. den Messprozess die Beobachtung in Teilen gestört und das zu Beobachtende unkontrolliert beeinflusst wird. Diese Behauptung betrifft nur die Tatsache der Beobachtung und des von ihr verwendeten Mediums, das Licht. Photonen, die etwa auf ein Elektron treffen, unterliegen dem Compton-Effekt, der sowohl die Wellenlänge des verwendeten Lichts wie auch den Impuls des Elektrons verändert. Daher kann nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit Ort und Impuls des betreffenden Elektrons bestimmt werden, die Unschärferelationen setzen hier eine physikalisch bestimmte Grenze der Beobachtbarkeit. Hönigswald bestreitet mit ausdrücklichem Bezug auf Heisenberg nicht den physikalischen Sachverhalt, sondern lediglich die damit verbundenen erkenntnistheoretischen Schlüsse; Licht ist nicht dasselbe wie Beobachtung, daher kann das Verhalten von Licht im Compton-Effekt seinerseits beobachtet werden. Die Quantenmechanik als physikalische Theorie bedarf wie jede physikalische Theorie des empirischen Gegenstandbezugs; sie setzt also Beobachtung als methodisches Prinzip voraus, sonst wären die Unbestimmtheitsrelationen selbst kein Gegenstand der Physik. Die Aussagen der Quantenmechanik betreffen nur die mit methodischer Beobachtung verbundenen empirischen Phänomene: auch festgestellte Störungen von Beobachtungsvorgängen sind als Störungen physikalische Tatsachen und unterliegen daher Konstanten und Bedingungen der Beobachtung. Selbst wenn sich die Beobachtungsobjekte je nach Beobachtungsmitteln und je nach Experiment verschieden darstellen, so bleibt doch das methodische Ziel hinreichender methodischer Bestimmtheit, wie es etwa in den Unschärferelationen gegeben ist. Dem entspricht, das jede physikalische Theorie der klassischen und modernen Physik zuletzt Anschauungsbezüge, und seien sie noch so indirekt, aufweist. Je nach Theorie kann ein Phänomen schon hochkomplex theoretisch bestimmt sein, etwa Interferenzphänomene am Doppelspalt, deren Verständnis den Begriff „Beugung“ und eine Wellenbeschreibung voraussetzen. Die Beobachtung einer Wasserwelle, die beim Fallen eines Steins entsteht, scheint dagegen wesentlich direktere Anschauungsbezüge zu enthalten. Die Begriffe, an denen sich die Theorie bestimmt, stehen unter den Bedingungen der Anschauung. Beobachtung als methodisches Prinzip der Physik bleibe daher für die klassische wie für die moderne Physik methodisch konstitutiv (Vgl. [6. S. 101–105]).
Hier findet Hönigswald für den Welle-Teilchen-Dualismus eine durchaus befriedigende erkenntnistheoretische Deutung. Die Wellentheorie bezieht sich auf Kollektive, die Partikelvorstellung auf distinkte Teilchen. Beide aber erfordern im Licht der Quantentheorie sich gegenseitig als methodische Grenzbegriffe der physikalischen Theorie. Auflösungsvermögen in Abhängigkeit von der verwendeten Wellenlänge, De-Broglie-Wellenlängen und Unschärferelationen geben dabei die Größenordnungen an, nach denen die eine in die andere theoretische Beschreibung wechseln muss und quantenmechanische und klassische Beschreibung ineinander übergehen [19. S. 72–74]. Daher drückt der Welle-Teilchen-Dualismus keine ontologische, sondern eine physikalische Besonderheit aus, die selbst wiederum den Wechselbezug von Theorie und Anschauung repräsentiert. Je nach theoretisch-experimentellem Gesichtspunkt bestimmt sich, was als jeweils „Eines“ gemeint ist, eine Welle oder ein Teilchen. Beides bedarf der Anschauung ebenso, wie der Dualismus selbst nur als physikalisch sinnvolles Phänomen zu bestimmen möglich ist aufgrund seiner in der Anschauung gegebenen Elemente. Quantenmechanische Experimente wie die Elektronenbeugung oder der Doppelspaltversuch mit Elektronen sind nur deshalb Phänomene der Physik, weil sie auf der Grundlage der Theorie beobachtet, gemessen und experimentell untersucht werden können. Auch der Welle-Teilchen-Dualismus ist ein Gegenstand der Physik und als Gegenstand daher nur vorhanden unter den methodischen Bedingungen der Quantenmechanik. Denn physikalische Gegenstände sind keine Substanzen oder Dinge, sondern methodisch notwendige Setzungen [6. S. 114–117].
Ebenso wird der zweite Kern der Kopenhagener Deutung, Bohrs Komplementaritätsprinzip, als spezifisch methodischer Ausdruck eines erkenntnistheoretischen Grundproblems behandelt und aufgelöst [6. S. 118–124]. Die Forderung, auch die Resultate und Messungen der Quantenmechanik müssten schließlich in der Sprache der klassischen Physik formuliert werden, weil nur dort unsere Alltagserfahrung mit physikalischen Geräten operieren kann, repräsentiert ein weiteres Mal das zugrundeliegende transzendentale Wechselverhältnis von Anschauung und Begriff. Hönigswald bestreitet hier, dass es einander ausschließende theoretische Beschreibungen der einen Natur bzw. Erfahrung geben könne. Sowenig es eine anschauungslose Theorie gebe, sowenig auch theoretisch unbegriffene isolierte Anschauungen bzw. Anschauungskomplexe. Klassische und moderne Physik gleichermaßen stehen in methodischer Korrelation auf der Grundlage der transzendentalen Korrelation von Anschauung und Theorie. Der im Komplementaritätsprinzip festgeschriebene Gegensatz entstammt auf der Grundlage der Erfahrung einer physikalischen Problemstellung, die den „einheitlichen Bestand der Physik doch allenthalben gewahrt“ [6. S. 118]. Daher gibt es nicht zwei oder mehr „Physiken“. Die Bedingungen von Theorie und Anschauung verteilen sich auf „vollentfaltete Dimensionen“ der wissenschaftlichen Argumentation, wobei die Anschaulichkeit der klassischen Physik selbst schon eine hochkomplexe theoretische Gestalt angenommen hat, auf die sich die Quantentheorie zuletzt bezieht. Denn klassische und moderne Physik stehen als dieselbe Physik in einem methodischen Verhältnis, das sich sowohl physikalisch als auch erkenntnistheoretisch eindeutig bestimmen lässt. Pointiert ausgedrückt, stehe die klassische Physik auf der Seite der Anschauung, die Quantentheorie auf Seiten der Theorie. Abstand und Wechselbezogenheit beider Theoriensysteme repräsentieren erkenntnistheoretisch die Relationsstruktur von Anschauung und Theorie, beide bedingen und fordern sich gegenseitig und stellen einen methodologisch einheitlichen Sachverhalt dar. Allgemeinere physikalische Theorien, die auf die Aufhebung des theoretischen Gegensatzes gerichtet sind, bleiben möglich; auch sie würden, folgt man Hönigswald weiter, der Struktur der physikalischen wie allgemeinen Erfahrung entsprechen müssen. Es bleiben funktionale Konstanten: die Möglichkeit, Naturgesetze zu finden und in mathematischen Gleichungen mit Hilfe bestimmter Naturkonstanten ausdrücken zu können, ist unabhängig von der je klassischen oder quantenmechanischen Form. Die Quantenmechanik stellt so einen erneuten Antrieb dar, die Einheit physikalischer Fragestellung und damit aus erkenntnistheoretischer Sicht auch den Begriff der Physik zu sichern. Denn die „unanschauliche Höhe der Theorie“ muss sich zuletzt an beobachtbaren und daher auch anschauungsbezogenen Instanzen bewähren, also an den durch die klassische Physik formulierten Begriffen und Prozessen der physikalischen Messung und Beobachtung. So zeigen sich in diesem dynamischen Wechselverhältnis Zusammenhang und Kontinuität der Erfahrung.
Damit kann Hönigswald eine weitere Behauptung zurückweisen. Keineswegs hebt die Quantenmechanik das Prinzip der Kausalität auf, sondern bestätigt es und setzt es wie die Physik insgesamt als transzendentale Bedingung ihrer Möglichkeit voraus. Wenn in der Physik von Kausalgesetzen gesprochen wird, sind damit deterministische Gesetze gemeint, die einer bestimmten mathematischen Gestalt unterliegen. Dann ist es in der Physik selbst sinnvoll und notwendig, davon nichtdeterministische, statistische Abhängigkeiten unterscheiden zu müssen. Doch der Begriff des deterministischen Kausalgesetzes fällt nicht mit dem Begriff der Kausalität zusammen, der ein apriorisches kategoriales Prinzip jeder möglichen Erfahrungserkenntnis und damit auch jeder besonderen Physik ist. Die Kausalität ist Prinzip jeder empirischen Gegenstandsbestimmung und daher notwendige Bedingung jeder Naturerkenntnis. Die kausale Verknüpfung bedingt den Zusammenhang von anschaulich gegebenen „Erscheinungen“ nach Regeln, welcher besonderen Art diese auch immer in der physikalischen Betrachtung sein mögen. Die Aufhebung des Kausalitätsprinzips würde bedeuten, dass überhaupt keine Regeln und Zusammenhänge in der Natur festgestellt werden könnten. Kausalität ist daher ein methodologisches Prinzip, das den Rahmen bestimmt, innerhalb dessen Physik überhaupt möglich ist. Sowenig daher eine Theorie der Beobachtung ein möglicher Gegenstand der Physik sein kann, sowenig auch der Begriff der Kausalität und der Begriff der Physik selbst.
Denn der Begriff der Kausalität wird nicht durch Abstraktion aus einer Vielzahl von beobachteten Einzelfällen gewonnen, sondern ist vielmehr das Prinzip, nach dem überhaupt ein empirischer Einzelfall als ein Gegenstand der Physik und Erfahrung bestimmt werden kann. Daher kann die Kausalität keine Hypothese sein, die an der Erfahrung geprüft werden könnte, da sie selbst das Prinzip dieser Prüfung ist. Auch in den quantenmechanischen Fällen, in denen die Messgenauigkeit Störungen der Beobachtung unterliegt, ist der Einfluss dieser Störungen ein solcher, dir kausal beschrieben werden kann. Unbestimmtheiten bestimmter physikalischer Begriffe unterliegen in den Unschärferelationen einschränkenden Bedingungen, die ihrerseits kausale Gründe haben, da sie Grenzen der Messgenauigkeit definieren. Die Möglichkeit, physikalische Ereignisse in einen Kontext der Naturerkenntnis einzugliedern, beruht ebenfalls auf dem Prinzip der Kausalität, da es die Eindeutigkeit des Naturverlaufs und -zusammenhangs bestimmt. Kausalität ist damit sowohl das Prinzip möglichen Naturzusammenhangs wie auch seiner begrifflichen Erfassung in der physikalischen Theorie. In diesem Sinne sind nicht nur klassische Gesetze eindeutig, sondern auch die quantenmechanischen: Die Unbestimmtheitsrelationen geben gerade den Rahmen und die Bedingungen an, unter denen Nichteindeutigkeit physikalisch geboten erscheint – es ist eben nicht Beliebiges unbestimmt, sondern etwa das Produkt von Energie und Zeit oder Ort und Impuls. In dieser Hinsicht bestimmt auch die Quantenmechanik Eindeutigkeit des Naturgeschehens, indem sie z. B. Grenzen der Anwendbarkeit klassischer Begriffe und Gesetze auf mikrophysikalische Phänomene festlegt [6] (143 ff), [7].
Aktualität und Ausblick
Zu einer weiteren Diskussion zwischen den Beteiligten zu den erkenntnistheoretischen Grundlagen der modernen Physik kam es nicht mehr. Hönigswald und Cassirer emigrierten in die USA und starben dort 1947 bzw. 1945, von der Laue übernahm nach dem Krieg maßgebliche Funktionen in der akademischen Neuorganisation der Physik. Und der Neukantianismus als philosophische Richtung war endgültig Geschichte. Zwar wurde das kritizistische Programm seit den späten fünfziger Jahren in Gestalt einer an Kant orientierten, postneukantianischen Transzendentalphilosophie vor allem von Hans Wagner und anderen bis in die Gegenwart weitergeführt. Doch gegenüber den Arbeiten zur Grundlegung einer erneuerten transzendentalphilosophischen Systematik erschienen die Grundlegungsfragen der modernen Physik als weniger drängend. Doch die von Cassirer und Hönigswald aufgeworfenen erkenntnistheoretischen Fragen erscheinen auch heute nach wie vor ungelöst. Es ist hier an den Sachstand der damaligen Diskussion anzuknüpfen und diese unter aktuellen Bedingungen weiterzuführen. Erkenntnistheoretisch sind nach wie vor zu untersuchen:
- eine allgemeine Theorie der Erfahrung und ihrer Gegenstände im Kontext einer Systematik der Wissenschaften
- eine Theorie der Kausalität als Kategorie und methodologisches Prinzip der Erfahrungswissenschaften, insbesondere der Physik
- eine Theorie der Beobachtung als Grundlage einer physikalischen Theorie der Messung und der Messprozesse
- schließlich eine Theorie, die Quantenobjekte als physikalische Gegenstände der Erfahrung begreifen lässt.
Mit den Worten Hönigswalds: Es ist erkenntnistheoretisch zu untersuchen, wie sich etwa der Begriff der Messung zu dem verhält, was ein physikalischer Gegenstand „ist“. Das ist nicht ontologisch gemeint. Gegenstände sind durch Methoden gegeben und erhalten erst durch Methoden ihren spezifischen Sinn: Was etwa ein Quantenobjekt außerhalb des quantenmechanischen Kontextes (sonst) noch sein mag, ist keine Frage der Physik mehr, sondern höchstens Problem einer transzendentalen Theorie der Erfahrung. Es ist die Frage zu stellen, aufgrund welcher methodischen Bedingungen ein Gegenstand der Erfahrung als „Quantenobjekt“ zu bestimmen ist. Denn wissenschaftstheoretische Probleme sind zuletzt, wie wir von Hönigswald lernen können, erkenntnistheoretische Probleme.
Auch aus physikalischer Sicht stehen sowohl die Kopenhagener Deutung wie auch modernere Interpretationen des quantenmechanischen Formalismus vor der Frage, wie eine sinnvolle Interpretation in konsistenten begrifflichen Zusammenhängen der Messergebnisse und Messprozesse möglich wird. Bohrs Forderung, die Resultate quantenmechanischer Experimente müssen in der Sprache der klassischen Physik beschreibbar sein, drückt eigentlich nur aus, dass geeignete Begriffe der Physik auf beide Beschreibungsebenen anzuwenden sind. Es sind daher Bedingungen anzugeben, die die Reichweite und Tragfähigkeit klassischer Begriffe auf quantenphysikalische Ereignisse begrenzen und umgekehrt. Das aber leisten die Unschärferelationen. Verbunden sind damit methodische und begriffliche Revisionen: Begriffe wie Zustandsgröße, „Teilchen“ oder „Welle“ korrelieren im Begriff des Quantenobjekts. Die „Paradoxien“ der Quantentheorie sind auf dem Hintergrund moderner Experimente heute empirisch schärfer belegt als jemals zuvor – die Wissenschaftstheorie täte daher gut daran, diesen Umstand einer erneuten Analyse zu unterziehen.
Denn neopositivistische und analytische Wissenschaftstheorien geben bis heute wenig hilfreiche Antworten auf ein falsch gestelltes erkenntnistheoretisches Problem. Es geht nicht darum, die Arbeit der Physiker „noch einmal“ zu tun, um etwa quantenmechanischen Begriffen einen vorgeblichen erkenntnistheoretischen Sinn abzugewinnen. Für die Geltung und methodische Bedeutung dieser Begriffe leistet beispielsweise die Rede von „theoretischen Termini“ wenig. Denn es bleibt die Frage, wie bestimmte theoretische Termini einen methodisch gültigen Gegenstandsbezug sichern können und auf welcher erkenntnistheoretischen Grundlage sie dies leisten. So stehen für transzendentalphilosophische Studien die Chancen auf einen erheblichen Beitrag für eine erkenntnistheoretische Grundlegung der modernen Physik nicht schlecht, gerade weil sie nicht einem realistisch-analytischen Mainstream folgen müssten. Die Arbeiten Cassirers und Hönigswalds haben hier paradigmatischen Charakter. Doch während aus post-Neukantianischer Sicht die Arbeiten Cassirers zur Quantenphysik eher einen Abschluss darstellen, warten auf eine post-Neukantianische Transzendentalphilosophie in Hönigswalds Nachlass-Schriften zu Grundlagenfragen der modernen Physik noch ungehobene Einsichten und Forschungsperspektiven. Ihnen ist in weiteren Studien nachzugehen.
About the authors
Reinhold Breil
RWTH Aachen University
Author for correspondence.
Email: reinhold.breil@rwth-aachen.de
PhD in Philosophy, Associate Professor, Institute of Philosophy 55 Templergraben, Aachen, 52056, Germany
References
- Neumann Jv. Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Berlin: Verlag von Julius Springer; 1932.
- Baumann K, Sexl R. Die Deutungen der Quantentheorie. Braunschweig [u.a.]: Vieweg; 1984.
- Lüth H. Quantenphysik in der Nanowelt. Schrödingers Katze bei den Zwergen. Berlin: Springer Spektrum; 2014.
- Cassirer E. Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. In: Schmücker R, editor. Gesammelte Werke. Bd. 10. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2001.
- Cassirer E. Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik. Historische und systematische Studien zum Kausalproblem. In: Rosenkranz C, Recki B, editors. Gesammelte Werke. Bd. 19. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2004.
- Hönigswald R. Grundprobleme der Wissenschaftslehre: Über die Struktur der Physik. Kausalität. Schriften aus dem Nachlass. Bd. 5. Im Auftr. d. Hönigswald-Archivs. Wolandt G, Schmitt H, editors. Stuttgart: Kohlhammer; 1965.
- Hönigswald R. Kausalität und Physik. Eine methodologische Überlegung. (Vorgelegt von Herrn von Laue). Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phys.-Math. Klasse. Berlin: 1933. S. 568-578.
- Hönigswald an Cassirer. 08. April 1937. Ernst Cassirer: Ausgewählter wissenschaftlicher Briefwechsel. Krois JM, Lauschke M, Köhnke KC, editors. In: Gesammelte Werke. Bd. 18. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2009. S. 173-175.
- Cassirer E. Substanzbegriff und Funktionsbegriff: Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik. Text und Anm. bearb. von Reinold Schmücker. Recki B, editor. In: Gesammelte Werke. Bd. 6. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2000.
- Ihmig KN. Grundzüge einer Philosophie der Wissenschaften bei Ernst Cassirer. Cassirer E, editor. Darmstadt: Wiss. Buchges.; 2001.
- Heisenberg an Cassirer, 24. März 1937. Ernst Cassirer: Ausgewählter wissenschaftlicher Briefwechsel. Krois JM, Lauschke M, Köhnke KC, editors. In: Gesammelte Werke. Bd. 18. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2009. S. 166.
- Einstein an Cassirer, 16. März 1937. Ernst Cassirer: Ausgewählter wissenschaftlicher Briefwechsel. Krois JM, Lauschke M, Köhnke KC, editors. In: Gesammelte Werke. Bd. 18. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2009. S. 158-160.
- Schrödinger an Cassirer, 09. Mai 1937. Eine Entdeckung von ganz außerordentlicher Tragweite. Schrödingers Briefwechsel zur Wellenmechanik und zum Katzenparadoxon. Meyenn Kv, editor. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2011. S. 588-590.
- Born an Cassirer, 19. März 1937. Ernst Cassirer: Ausgewählter wissenschaftlicher Briefwechsel. Krois JM, Lauschke M, Köhnke KC, editors. In: Gesammelte Werke. Bd. 18. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2009. S. 160-162.
- Von Laue an Cassirer, 23. März 1937. Ernst Cassirer: Ausgewählter wissenschaftlicher Briefwechsel. Krois JM, Lauschke M, Köhnke KC, editors. In: Gesammelte Werke. Bd. 18. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2009. S. 164-166.
- Von Laue an Cassirer, 26. März 1937. Ernst Cassirer: Ausgewählter wissenschaftlicher Briefwechsel. Krois JM, Lauschke M, Köhnke KC, editors. In: Gesammelte Werke. Bd. 18. Hamburger Ausgabe. Hamburg: Felix Meiner Verlag; 2009. S. 167-170.
- Laue Mv. Zu den Erörterungen über Kausalität. Die Naturwissenschaften. 1932;(20):915-916.
- Laue Mv. Über Heisenbergs Ungenauigkeitsbeziehungen und ihre erkenntnistheoretische Bedeutung. Die Naturwissenschaften. 1934;(22):439-441.
- Rennert P. Einführung in die Quantenphysik. Chassé A, Hergert W, editors. Wiesbaden: Springer Spektrum; 2013.
Supplementary files