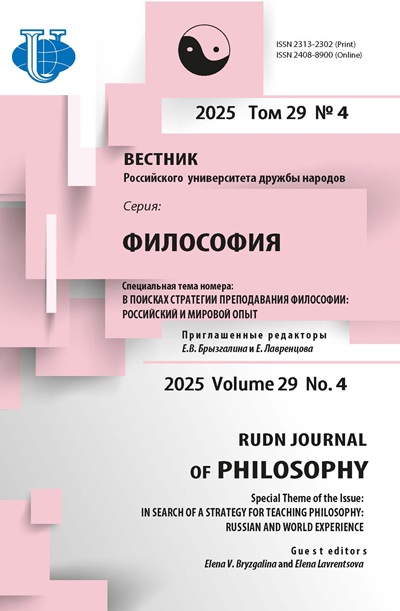Post-Neo-Kantianism and the Problem of Revival of Systematic Transcendental Philosophy
- Authors: Zeidler K.W.1, Belov V.N.2, Perepechina A.S.2
-
Affiliations:
- University of Vienna
- RUDN University
- Issue: Vol 28, No 3 (2024): POST-NEO-KANTIANISM
- Pages: 635-652
- Section: POST-NEO-KANTIANISM
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/40981
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-3-635-652
- EDN: https://elibrary.ru/YDGLDL
- ID: 40981
Cite item
Abstract
With a view to the question of a possible revival of systematic transcendental philosophy, the article follows the problem developments from outgoing neo-Kantianism to post-neo-Kantianism to the present day. Neo-Kantianism decisively determined this development, since, following the ‘analytical method’ of the prolegomena, it based its principletheoretical claim on the ‘factum of science’ and other facta of culture. Since the fact of science and culture at the beginning of the 20th century has changed. However, this ‘validity objectivism’ rapidly lost credibility. Although he was also criticized within neo-Kantianism (Emil Lask, Paul Natorp), these isolated approaches and calls for a renewal and deepening of the reflection of principles remained ineffective, since one sought salvation rather in the forced orientation to individual sciences or in new Orthodoxies and academic ‘research’. For a continuity of transcendental philosophical questions, but by no means for a revival of the systematic transcendental philosophy, the works of vom Verf. under the title Kritische Dialektik und Transcendentalontologie , post-neo-Kantian approaches of the interwar and post-war period by Richard Hönigswald and Wolfgang Cramer, Bruno Bauch and Hans Wagner, as well as Robert Reininger and Erich Heintel, documented a systematically oriented succession in the works of Werner Flach and Harald Holz to the present day, and - under conditions of philosophy of consciousness - in the works of Dieter Henrich and Karl-Otto Apel, an at least there was a thematic continuation. However, a “revival of systematic transcendental philosophy” would require more radical approaches than have been delivered in the last 100 years: it would simply require a return to the ‘synthetic method' of critique of reason , which “bases nothing as a given, except reason itself”.
Full Text
Der Terminus „Post-Neukantianismus“ ist Ausdruck der Verlegenheit, in die uns das ‚Problem einer Wiederbelebung der systematischen Transzendentalphilosophie‘ bringt, da der Neukantianismus ein Trümmerfeld hinterließ. Obwohl er sich der Erneuerung der systematischen Transzendentalphilosophie verschrieben hatte, wurde er zum Drehkreuz und Einfallstor für Entwicklungen, die dazu führten, daß ‚Philosophie‘ heute nur noch ein Name für eine Vielzahl an Sonderwegen und speziellen Forschungsprogrammen ist. Insoweit ist die Philosophie der Gegenwart durch und durch ‚post-Neukantianisch‘, ist der Neukantianismus doch auf verhängnisvolle Weise aufgrund seiner prinzipientheoretischen Mängel geschichtsmächtig geworden. Da er nicht dem Anspruch der ‚synthetischen Methode‘ der Vernunftkritik folgte, die, „ohne sich auf irgendein Factum zu stützen, […] nichts als gegeben zum Grunde legt, außer die Vernunft selbst“, sondern der ‚analytischen Methode‘ der Prolegomena, „die sich auf etwas stützen, was man schon als zuverlässig kennt“ (Kant, Prolegomena § 4, AA IV, S. 274f.), gründete er seinen prinzipientheoretischen Anspruch auf das ‚Factum der Wissenschaft‘ und andere Facta der Kultur und wurde daher von der Geschichte überrollt. Der ‚Geltungsobjektivismus‘, die Stilisierung von Fakten – dem ‚Faktum der Wissenschaft‘ und sonstigen Fakta der ‚Kultur‘ – zu Prinzipien, konnte glaubwürdig erscheinen, solange die Verschränkung von Geltungsobjektivismus und Kulturidealismus die prinzipientheoretischen Mängel kaschierte. Sie verlieh in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der vorschnellen Vermengung von Fakten und Prinzipien eine vordergründige und zeitgemäße Plausibilität, die entscheidend zum Aufstieg des Neukantianismus zu der führenden Universitätsphilosophie beitrug. Da sich die Fakta der Wissenschaft und der Kultur, auf die sich der Neukantianismus berufen hatte, zu Beginn des 20. Jahrhunderts dramatisch veränderten, wurden seine Mängel jedoch offenkundig.
Blicken wir hundert Jahre zurück, dann zeigt sich, daß bereits im Kantjahr 1924 die Auflösungserscheinungen des Neukantianismus unübersehbar geworden waren [1. S. 22ff.]. So verfaßt in diesem Jahr Heinrich Rickert, mit seinem Nachruf für Alois Riehl zugleich einen ‚Nachruf‘ auf den Neukantianismus: „O. Liebmann, F.A. Lange, besonders aber H. Cohen, W. Windelband und P. Natorp [...] werden mit Recht Neukantianer genannt, denn sie führten dadurch, daß sie auf Kant zurückgingen, die wissenschaftliche Philosophie zugleich erheblich vorwärts. [...] Riehl war der letzte dieser Gruppe. Er hat alle anderen Neukantianer von Wichtigkeit […] überlebt, so daß mit ihm der Neukantianismus als eine geschichtliche Erscheinung sein Ende findet. Heute gibt es keinen Denker von selbständiger Bedeutung mehr, auf den der Name eines Neukantianers paßt, und das kann nicht anders sein. Der Neukantianismus in dem hier angegebenen Sinne hat seine Arbeit [...] im entscheidenden Punkte vollendet: die Grundbegriffe der Kantischen Schriften [...] haben durch die Werke des Neukantianismus eine Gestalt erhalten, in der jeder sie zu verstehen vermag, der überhaupt zu philosophischem Denken fähig ist.“ [2. S. 164] Diese Ausführungen bezeugen nicht nur, wie Rickert trotz der Proklamation des Endes des Neukantianismus dennoch weiterhin an dessen historischem Selbstverständnis festhält, sie dokumentieren auch die schulmeisterliche Enge des Rickertschen Philosophieverständnisses, das den ‚regen Auswanderungstrieb‘ (J. Ebbinghaus) seiner Schüler wohl nicht unwesentlich beflügelt hat.
An ihrer Spitze steht Richard Kroner, der seine klassische Darstellung des Weges Von Kant bis Hegel im Jahre 1924 mit der Veröffentlichung des zweiten Bandes vollendet. Diesem Grundwerk der ‚Hegel-Renaissance‘ (Heinrich Levy [3]) geht es vor allem um eine zeitgemäße Adaption des Transzendentalismus, insofern die für den Wertkritizismus der Windelband-Rickert-Schule ebenso konstitutive wie unauflösliche Spannung zwischen (transzendentaler) Systemund (existentialistischer) Lebens-Philosophie, zwischen dem „theoretisch geordnete[n] Reich von Begriffen“ [4. S. 148] einerseits und der „Unmittelbarkeit und irrationalen Anschaulichkeit“ des erlebenden Lebens [4. S. 75] andererseits, im Rückgriff auf Hegel bewältigt werden soll, dessen Dialektik der Rickert-Schüler Kroner als den „zur Methode [...] gemachte[n] Irrationalismus“ interpretiert [5. S. 272]. Eine unmittelbar bevorstehende Erneuerung des Hegelianismus hatte freilich schon im Jahre 1910 das Schulhaupt Windelband vorausgesehen. Der Hegelianismus ist für Wilhelm Windelband die Konsequenz eines Entwicklungsganges, der den Kritizismus zwischen den beiden Gefahren des Psychologismus und des Historismus hindurchmanövriert und der sich daher in der Geschichte des Kantianismus regelmäßig wiederholt: er ist „der Weg von Fries zu Hegel“, und „mit einer Art von grotesker Vergrösserung und Vergröberung hat man jenen Weg [...] noch einmal durchlaufen müssen. Die Erneuerung des Kantianismus, wie sie vor fünfzig Jahren einsetzte, war [...] einseitig erkenntnistheoretisch orientiert, und schon deshalb lief sie [...] sehr bald in Psychologismus aus und verstrickte sich in einen Relativismus, dem die Vernunftwerte unter den Händen zerrannen in anthropologische Notwendigkeiten und Erforderlichkeiten.“ [6. S. 282f.] Allmählich habe aber die Philosophie „zu dem ganzen Kritizismus zurückgefunden, der die historische Grundlage verlangt [...], und seitdem Lotze die Rücksicht auf das Reich der Werte als entscheidendes Moment bereits für die logische Theorie eingeführt hatte, wurde dem philosophischen Denken die ganze Fülle der historischen Entwicklung der Vernunftwerte von neuem als das fruchtbare Feld für seine begriffliche Durcharbeitung eröffnet. Das ist der Sieg, den Hegel von neuem über Fries zu erringen im Begriffe ist.“ [6. S. 284] Windelband erkennt aber auch schon deutlich das Doppelgesicht der künftigen Hegel-Renaissance, da er in ihr die Gefahr des Abgleitens in den Historismus und zugleich einen vielversprechenden Ansatz zur Überwindung dieser Gefahr erblickt: der Sieg über den Psychologismus darf demnach nicht „durch den Verfall in den Historismus“ erkauft werden, „welcher eine mindestens ebenso bedenkliche Art des Relativismus ausmacht, wie der Psychologismus. Die Bedeutung der Geschichte als des Organon der Philosophie darf nicht besagen, daß nun alles historisch Geltende als Vernunftwert einfach hingenommen werden soll. [...] Gerade in dieser Hinsicht aber bietet die hegelsche Philosophie zur Überwindung jener Gefahr des Historismus selber die beste Waffe.“ [6. S. 284f.] Auch die ‚beste Waffe‘ nützt uns allerdings wenig, solange wir nicht wissen, wie sie zu handhaben ist. Windelbands Vorsatz, mit den Mitteln der „hegelschen Methode [...] aus dem historischen Kosmos, wie ihn die Erfahrung der Kulturwissenschaften darbietet, die Prinzipien der Vernunft herauszuarbeiten“ [6. S. 283], setzt darum seinerseits die Entschlüsselung der Vernunftprinzipien in der ‚hegelschen Methode‘ voraus. Soweit der Neuhegelianismus nur bestrebt war, die ‚Prinzipien der Vernunft‘ aus dem „historischen Kosmos“ herauszuarbeiten (Windelband), war er daher bloß die hegelianisierende Verlängerung des neukantianischen Geltungsobjektivismus.
Im Interesse einer prinzipientheoretischen Klärung der ‚Vernunft‘ war darum an beide, an den Neukantianismus ebenso, wie an den Neuhegelianismus, die Frage zu richten, ob sie nicht vielleicht – getreu dem Windelbandschen Motto: „Kant verstehen, heißt über ihn hinausgehen“ – allzu voreilig über den historischen Kant hinausgegangen waren. In dem Zusammenhang ist vor allem an Julius Ebbinghaus zu erinnern, der zunächst selbst als streitbarer Vorkämpfer des Hegelianismus in der Windelband-Rickert-Schule hervortrat [7; 8. S. 136]. In dem Aufsatz Kantinterpretation und Kantkritik (1924) entlarvt er jedoch „die Erzeugnisse des auf der ganzen Front der Neukantianer regen Auswanderungstriebes [...] als ein immanentes Zersetzungsprodukt dieser Neukantischen Philosophie“, die mit Blick auf Kant „fortwährend mit einer großen Unbekannten“ gerechnet habe, und hält darum der „aus dem Nichtfertigwerden mit Kant hervorgegangenen Neufichteschen, Neuschellingschen, Neuhegelschen Zersetzungsliteratur“ die Notwendigkeit „einer bis aufs Letzte durchgreifenden Zergliederung der Kritik der reinen Vernunft“ entgegen [9. S. 82f.].
Ebbinghaus kritisiert in seinem Aufruf zu einer neuen Kant-Orthodoxie vor allem die „zirkelkonstruierende Interpretation“ der Neukantianer, die aus der Orientierung am Faktum der Wissenschaft und an sonstigen kulturellen Objektivationen resultiert, wobei er diesem „getadelten, entschuldigten und schließlich gar als unvermeidlich gebilligten Zirkel der kantischen Beweisführung“ mit dem Hinweis begegnet, daß Kant „gar keine Erkenntnis als objektiv gültig voraus[setzt], sondern [...] allein etwas voraus[setzt], aus dem sich zwar nicht ergibt, daß irgend eine Erkenntnis objektiv gültig ist, wohl aber, daß es notwendig möglich ist, Vorstellungen hinsichtlich des Charakters der objektiven Gültigkeit zu bestimmen.“ [9. S. 85f.]. Wenn Ebbinghaus allerdings bezweifelt, „daß die verwunderlichen Verrenkungen, denen man in der Kantliteratur begegnet, sobald es sich um die transzendentale Einheit der Apperzeption handelt, möglich gewesen wären, wenn man sich den einfachen Grundtatbestand: apriorische Bestimmtheit aller Vorstellungen mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer Synthese gemäß der Bedingung durchgehender Einheit des Mannigfaltigkeitsbewußtseins – stets mit der nötigen Ruhe verdeutlicht hätte“ [9. S. 89], dann ist dem doch entgegenzuhalten, daß der ‚einfache Grundtatbestand‘ gar so einfach nicht ist, weil die Bestimmung der ‚apriorischen Bestimmtheit‘ (die Fundierung der Kategoriensystematik im ‚Leitfadenkapitel‘) ein ebenso grundsätzliches wie ungelöstes Problem darstellt. Mit der Kantischen „Entdeckung der Identität zwischen den apriorischen Bestimmtheitsmöglichkeiten im Hinblick auf die einheitsgemäße Synthesis d.i. den Kategorien und den apriorischen Bestimmtheitsmöglichkeiten der Vorstellungen im Hinblick auf die Urteilsfunktionen“ [9. S. 91]., ist ja noch keineswegs ein Beweis für die systematische Vollständigkeit dieser „apriorischen Bestimmtheitsmöglichkeiten“ und damit eben auch keine vollständige Bestimmung der ‚transzendentalen Einheit der Apperzeption‘ erbracht.
Da Ebbinghaus die Brisanz des Problems bewußt ist, versucht er Kant von der Beweislast zu befreien, indem er behauptet, es handle „sich für Kant grundsätzlich nicht darum, daß die Aufgabe [sc. des Nachweises der Vollständigkeit der ‚Urteilsformen‘ und Kategorien] absolut gelöst ist – das unterliegt der Kritik – ,,sondern darum, daß sie als eine, deren Lösungsmöglichkeiten a priori bestimmt sind, erkannt ist“ [9. S. 92]. Damit entfernt sich Ebbinghaus jedoch in einem entscheidenden Punkt vom historischen Kant, der ausdrücklich die „a priori bestimmt[e] Vollständigkeit“ der reinen Verstandesbegriffe fordert (KrV A 67/B 92). Im Bewußtsein des Problems hat Julius Ebbinghaus deren spätere Auflösung durch seinen Schüler Klaus Reich freudig begrüßt, in Reichs Versuch eines ‚analytischen‘ Beweises der Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel (Berlin 1932) „die Aufschließung des Geheimnisses der Kritik der reinen Vernunft“ erblickt [10. S. 2074] und eine ‚Neubearbeitung‘ seines Aufsatzes aus dem Kantjubiläumsjahr vorgelegt, in der nicht mehr bloß die „Lösungsmöglichkeiten“ der metaphysischen Deduktion apriorisch bestimmt sind, sondern deren „Lösbarkeit“, wobei er erneut auf die „bahnbrechende Arbeit von Klaus Reich“ verweist [11. S. 9]. Ob der Versuch Klaus Reichs, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel auf „analytischem“ Wege aus der „Quaeitas“, der Einheit von relationaler und modaler Urteilsform (Kant, Refl. 3084, AA XVI, S. 650), herzuleiten, tatsächlich das ‚Geheimnis der Vernunftkritik‘ aufschließt, ist eine systematische Frage, die erfreulicherweise in den letzten drei Jahrzehnten wieder mit systematischem Anspruch diskutiert wird,[1] nachdem sie die längste Zeit nur unter historischem Aspekt behandelt wurde.
In diesem Zusammenhange darf allerdings nicht übersehen werden, daß auch die historische Behandlung des Kategorienproblems eine systematische Zielsetzung verfolgen kann. Der Aspekt darf um so weniger übersehen werden, als gerade aus dieser Richtung einer der wesentlichsten Anstöße für die (Selbst-)Auflösung des Neukantianismus erfolgte. Gemeint ist die Abhandlung Über Christian Wolffs Ontologie (Leipzig 1910) von Hans Pichler, die den Vorwurf Johann August Eberhards erneuert, wonach „die Leibnizsche Philosophie eben so wohl eine Vernunftkritik enthalte, als die neuerliche, wobei sie [...] alles Wahre der letzteren, überdem aber noch mehr, in einer gegründeten Erweiterung des Gebiets des Verstandes, enthalte“ (Kant, Ueber eine Entdeckung, AA VIII, S. 187). Indem er die Kantische Kategorienlehre als verkümmerten Sproß der ungleich reicheren ontologischen Begriffsbestimmungen Christian Wolffs kritisiert [12. S. 73ff.], gibt der Meinong-Schüler Hans Pichler der aus dem Marburger Neukantianismus entstehenden neu-ontologischen Geschichtsschreibung (Heinz Heimsoeth, Gottfried Martin) und ‚Kategorialanalyse‘ (Nicolai Hartmann) ihr zentrales Thema vor [13. S. 144ff.]. Es ist darum sachlich nicht ganz zutreffend, wenn Hans Wagner, dessen eigene transzendental-ontologische Systematik im übrigen ganz entscheidend durch Nicolai Hartmann geprägt ist, das Kantjahr 1924 gerade deshalb als ein „Epochenjahr“ in der Geschichte der Kantforschung und Kantdeutung bezeichnet, weil es „aus der Feder Max Wundts das Buch Kant als Metaphysiker und aus der Feder von Heinz Heimsoeth den großen Kantstudienbeitrag Metaphysische Motive in der Ausbildung des kritischen Idealismus“ brachte: dieses Jahr markiere darum den Beginn jener transzendental-ontologischen „systematische[n] Bewegung“, der der historische Kant „nun nicht mehr einfach als der Vorkämpfer eines rein erkenntniskritischen und wissenschaftstheoretischen Philosophierens gegen jede Art von metaphysischer Fragestellung“ gilt, und die daher den „Idealismus des Erkenntnisbegriffes und die Aufgaben von Ontologie, Realphilosophie und Metaphysik“ auch systematisch zu verbinden trachtet [14. S. 246]. Obwohl wir bereits gesehen haben, daß mit gleichem Recht auch noch andere ‚systematische Bewegungen‘ das Kantjahr 1924 als ‚Epochenjahr‘ für sich in Anspruch nehmen könnten, lohnt es dennoch dem Hinweis Hans Wagners folgend an dieser Stelle innezuhalten und sich etwas näher mit dem von Max Wundt gezeichneten Bilde des ‚metaphysischen‘ Kant vertraut zu machen.
Wundts Werk über Kant als Metaphysiker, das sich im Untertitel bescheiden ‚Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Philosophie im 18. Jahrhundert‘ nennt, versteht sich als Beitrag zur „deutschen Philosophie in ihrer hohen Linie von Leibniz bis Hegel“ [15. S. 17] und folgt damit im wesentlichen der ontotheologischen Kant-Interpretation, die zuvor schon Bruno Bauch in seinen Kantmonographien[2] vorgelegt hatte. Während jedoch Bauch die ontologischen Motive Kants für die erkenntniskritische Fragestellung fruchtbar zu machen versucht und insoweit dem Neukantianismus verpflichtet bleibt, blendet Wundt die Erkenntniskritik weitgehend aus, wenn er – im Gegenzug zur einseitigen erkenntniskritischen Auffassung der kantischen Philosophie bei Kuno Fischer, Cohen, Windelband, Vaihinger, Cassirer und Kroner [15. S. 188f.], derzufolge Kant „nicht ein Förderer oder gar Begründer deutscher Weltanschauung gewesen“ wäre [15. S. 2] – Kant für die „deutsche Philosophie in ihrer hohen Linie von Leibniz bis Hegel“ reklamiert [15. S. 17], den „alte[n] platonische[n] Glaube[n] an die Verwirklichung des Guten in der Welt“ zum „beseelende[n] Atem der kantischen Metaphysik“ erklärt [15. S. 433] und kurzerhand die „kritische Philosophie [...] in der Theologie“ gipfeln läßt [15. S. 434]. Mißt man die Unbekümmertheit, mit der Max Wundt den ‚alten platonischen Glauben‘, die ‚deutsche Weltanschauung‘, die ‚Theologie‘ und die ‚kritische Philosophie‘ miteinander identifiziert, an dem Gewicht der damit angesprochenen Probleme, dann ist die epochale Geltung, die Hans Wagner dem Wundtschen Beitrag zuschreibt, schwer verständlich. Zudem ist die metaphysische, theologisierende und an platonische Reminiszenzen anknüpfende Kantdeutung Wundts alles andere denn originell, läßt sie sich doch unschwer über Bruno Bauch, Rudolf Hermann Lotze und den ‚spekulativen Theismus‘ des 19. Jahrhunderts in die idealistische Überlieferung zurückverfolgen. Verfolgt man diese ‚hohe Linie‘ der deutschen Philosophie in umgekehrter Richtung über Bauch und Wundt bis in unsere jüngste Vergangenheit, muß man allerdings zugestehen, daß dem Wundtschen Werk in gewisser Weise dennoch epochale Bedeutung zukommt: es markiert den Beginn der Epoche, in der das neukantianische Programm der erkenntniskritischen Fundierung einer alle Kulturbereiche umspannenden Philosophie zu Grabe getragen und durch historisch-philologisch oder szientistisch orientierte Spezialforschungen einerseits, sowie durch unterschiedlichste Weltanschauungen andererseits ersetzt wurde. In diesem Zusammenhang kommt Wundts Arbeit über Kant als Metaphysiker, wenn schon nicht eine Schlüsselrolle, so doch eine in zweierlei Hinsicht aufschlußreiche Stellung zu: erstens, weil sie das philologisch-historische und das weltanschauliche Moment gerade in Betrachtung des Gegenstandes vereint, von dem jeder anspruchsvolle Versuch einer systematischen Rekonstruktion der in unterschiedliche Kompetenzen zersplitterten ‚Vernunft‘ auszugehen hätte; zweitens, weil die Weltanschauung, die Wundt an die Stelle der verlorengegangenen Einheit der Vernunft setzt, bereits die Züge des nationalistischen Ungeistes erkennen läßt, der schon bald die Austreibung der Philosophie aus der ‚Deutschen Philosophie‘ besorgen sollte.
Zieht man die schlichten Fakten, die Zahl und die Namen der 1933 ihres Amtes enthobenen und mit Lehrverbot belegten Philosophen, mit ins Kalkül, dann „kann und darf [man] der trostlosen Hypothese nicht ausweichen, daß nur dann erlaubt ist vom Ende des ‚Neukantianismus‘ zu reden, wenn man zugleich vom Antisemitismus und seinen katastrophalen Konsequenzen spricht. Solange das nicht geschehen ist, sind Beschreibungsmittel wie ‚Selbstauflösung‘ [...] nur wie Schleier […]. Begründende Vernunft wird dergleichen nicht akzeptieren.“ [16. S. 516] Wolfgang Marxens Hinweis auf die ‚begründende Vernunft‘, verweist uns wieder unmittelbar auf das philosophische Problem, das hinter den weltanschaulich-ideologischen Krämpfen des 20. Jahrhunderts steht, geht es dabei in letzter Instanz doch immer um die Frage, inwieweit wir überhaupt noch auf die Begründungsleistungen der ‚Vernunft‘ vertrauen können; denn sobald dieses Vertrauen verloren ist, machen sich Weltanschauungen breit und besetzen den Platz der begründenden Vernunft mit jeweiligen (sei es nun biologischen oder geschichtlich-geschicklichen oder sozio-ökonomischen) Gegebenheiten, die sie als das Innerste des Weltgetriebes glauben geschaut zu haben. Dem Neukantianismus ist darum vorzuwerfen, daß er aufgrund seiner ‚Kulturfrömmigkeit‘ zu keiner systematischen Klärung seines eigenen Verhältnisses zu den Weltanschauungsfragen gekommen ist [17. S. 79ff.]: in der leider allzu optimistischen Erwartung, „daß die Kulturentwicklung trotz allem eine kumulative Verwirklichung der Kulturgüter und damit letztlich auch eine kumulative Erkenntnis der – prinzipiell immer geltenden, aber erst nach und nach verwirklichten – Werte befördern werde“ [17. S. 99], bereitete er entgegen seinen eigenen systematischen Absichten einem Wertrelativismus den Weg, der dem weltanschaulichen Totalitarismus allenfalls mit resignativem Unverständnis (H. Rickert) oder mit der vagen Hoffnung auf eine künftige Verwissenschaftlichung der Politik (E. Cassirer) begegnen konnte [1. S. 29f.]. Es liegt nahe, anhand dieses Befundes die schlichte Schlußfolgerung zu ziehen, daß die Sozialwissenschaften und der Neopositivismus die legitimen Erben des Neukantianismus sind und daher nach dem Zweiten Weltkrieg zurecht den Platz der neukantianischen Kulturund Wissenschaftstheorie eingenommen haben. Insoweit bewegt sich die Gegenwart weitestgehend auf dem Boden eines halbierten Neukantianismus: sie hat seinem Kulturidealismus abgeschworen, hält aber an seinem Geltungsobjektivismus fest und versteht daher die prinzipientheoretischen Defizite des Neukantianismus als Beweis für das Scheitern jedes autonomen philosophischen und prinzipientheoretischen Ansatzes. Gleichwohl hat es aber auch im klassischen Neukantianismus nicht an Stimmen gefehlt, die darauf hinwiesen, daß der für die neukantianische Theoriebildung schlechterdings konstitutive Gedanke einer schöpferischen Ratio, die sich im Kulturschaffen manifestiert, aufgrund des Geltungsobjektivismus unausgewiesen blieb.
Mit Blick auf das ‚Epochenjahr 1924‘ ist vor allem an den in diesem Jahr verstorbenen Paul Natorp zu erinnern. Ebenso wie Emil Lask [18. S. 11–43], der von Seiten der Südwestdeutschen Schule die „Magdstellung der Spekulation [...] nicht nur gegenüber der Theologie, sondern gegenüber der Autorität des wissenschaftlichen Lebens überhaupt aufgehoben wissen“ will [19. S. 100] und daher nach einer „wahrhaft universale[n] Kategorienlehre nach den Prinzipien des Kantianismus“ sucht [19. S. 133], hat auch Paul Natorp die „Voraussetzung der unangreifbaren Sicherheit des ,Faktums‘ der Wissenschaft“ in Frage gestellt und erklärt, daß die „Wissenschaft selbst [...] der Begründung, nämlich kategoriale[n] Begründung“ bedarf [20. S. 209]. Das vom späten Natorp verfolgte Programm einer universalen Kategorienlehre oder ‚Allgemeinen Logik‘ kündigte sich bereits in seinem Aufsatz über Kant und die Marburger Schule (1912) an, wenn er betont, daß sich die „transzendentale Methode“ nicht erschöpft in der geltungsobjektivistischen Beziehung „auf die vorliegenden, historisch aufweisbaren Fakta der Wissenschaft, der Sittlichkeit, der Kunst, der Religion“, da sie vor allem den „schöpferischen Grund aller solchen Tat der Objektgestaltung“ herausarbeiten müsse, das „Urgesetz, das man noch immer verständlich genug als das des Logos, der Ratio, der Vernunft bezeichnet. Und das nun ist die zweite, die entscheidende Forderung der transzendentalen Methode: zum Faktum den Grund der ‚Möglichkeit‘ und damit den ‚Rechtsgrund‘ nachzuweisen, das heisst: eben den Gesetzesgrund, die Einheit des Logos, der Ratio in all solcher schaffenden Tat der Kultur aufzuzeigen und zur Reinheit herauszuarbeiten.“ [21. S. 196f.] Diese „zweite, die entscheidende Forderung der transzendentalen Methode“, die den Blick gleichermaßen auf die ‚synthetische Methode‘ der Vernunftkritik, wie auf den spekulativen Idealismus[3] lenkt, blieb eine unerfüllte und zudem in den folgenden Jahrzehnten totgeschwiegene Forderung.[4] Die offenkundigen Mängel des Neukantianismus wurden keineswegs zum Anstoß für die fällige Erneuerung und Vertiefung der Prinzipienreflexion. Vielmehr war das Gegenteil der Fall, da man zum einen, statt die Erneuerung des Idealismus in Angriff zu nehmen, sein Heil in der forcierten Orientierung an den Wissenschaften (Neo-Positivismus, analytische Philosophie und die diversen Bindestrich-Philosophien) oder in neuen Orthodoxien und akademischer ‚Forschung‘ suchte.
Für eine Kontinuität transzendentalphilosophischer Fragestellungen vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sorgten die unter dem Titel Kritische Dialektik und Transzendentalontologie [1] dokumentierten post-Neukantianischen Ansätze der Zwischenund Nachkriegszeit von Richard Hönigswald und Wolfgang Cramer, Bruno Bauch und Hans Wagner, sowie Robert Reininger und Erich Heintel. Im Ausgang vom realistischen Kritizismus.innerhalb des Neukantianismus [1. S. 65–73], erwiesen sie sich „gegenüber den lebensphilosophischen, ontologischen und positivistischen Zersetzungen des kritizistischen Ansatzes resistent“ [1. S. 6], weil sie „die ontologischen und die dialektischen Motive, die den wissenschaftslogischen Idealismus der Marburger und den Wertkritizismus der Südwestdeutschen zersetzten, als angestammte realistische Motive der Kantischen Philosophie interpretieren“ konnten [1. S. 73]. Da die systematische Rekonstruktion der Problementwicklungen vom Kantianismus über den Neukantianismus zum Post-Neukantianismus die „Revision einiger gängiger Vorurteile bezüglich des Neukantianismus“ verlangte [1. S. 6], stieß sie allerdings in der etablierten Neukantianismus-Forschung auf wenig Resonanz. Der Hinweis, daß Kant der prinzipientheoretischen Grundfrage aller drei Kritiken, der „Frage nach der Einheit der Vernunft“, durch „die Betonung der wissenschaftlichen Faktizität des Apriori in der zweiten Auflage der Vernunftkritik, die Zwei-Welten-Theorie der zweiten Kritik und die Rehabilitierung des ontotheologischen Ordo-Gedankens in der Kritik der Urteilskraft“ ausweicht und „die drei Hauptrichtungen des Neukantianismus […] jeweils einen der drei Ansätze verabsolutieren, die Kant seit der Mitte der 80er Jahre in (vorläufiger) Umgehung seiner prinzipientheoretischen Deduktionsabsichten in Anschlag bringt“ [1. S. 73], wurde nicht zum Anstoß für tiefergehende systematische Überlegungen. Lieber hielt man an der überkommenen Auffassung fest, daß es zwei Schulen des Neukantianismus, den wissenschaftslogischen Idealismus der Marburger und den Wertkritizismus der Südwestdeutschen Schule, gibt und bestritt insbesondere die Zuordnung Bruno Bauchs zur dritten Hauptrichtung eines realistischen Kritizismus. Es wäre unnötig diese Diskussion zu erwähnen,[5] wenn sie nicht die unglücklichen perspektivischen Verengungen dokumentierte, die den in der Gegenwart ohnehin ins Abseits gedrängten transzendentalsystematischen Ansatz zusätzlich belasten und den Außenstehenden das Bild eines degenerierenden Forschungsprogramms vermitteln, das nicht an Sachproblemen, sondern nur an der Deutung seiner eigenen Geschichte interessiert ist.
Nun kann man aber gerade dem realistischen Kritizismus die Orientierung an Sachproblemen nicht absprechen. Da ihm „die Schlüsselbegriffe Affektion, Affinität und Naturzweck […] sein Profil und eigentümliches Gepräge geben“, in denen „die realistische Dimension des Grundproblems der theoretischen Philosophie Kants […] eine dreifache Spezifikation erfährt: erstens in Richtung auf das empirische Subjekt des Erkennens (Affektion), zweitens hinsichtlich der logisch-kategorialen Bestimmtheit der natura formaliter spectata (Affinität), drittens hinsichtlich der gesetzmäßigen Bestimmbarkeit besonderer Naturerscheinungen (Naturzweck)“ [1. S. 68], kann man den Vertretern des realistischen Kritizismus allenfalls vorwerfen, daß ihnen nicht gelang, den Zusammenhang dieser Problemdimensionen auf systematisch überzeugende Weise zu klären. Trotz ihres Problembewußtseins und systematischen Anspruchs, mangelte es doch an dessen Einlösung, denn eine Kategorienoder Prinzipienlehre, die der logischen Klärung der Problemzusammenhänge dienen könnte, sucht man bei ihnen vergeblich. Während die ältere Generation: Richard Hönigswald (1875–1947), Bruno Bauch (1877–1942) und Robert Reininger (1869–1955), ihren realistischen Kritizismus in Auseinandersetzung mit der Marburger und der Südwestdeutschen Schule des Neukantianismus, sowie der zeitgenössischen Lebensphilosophie, der Neo-Ontologie, der Phänomenologie und dem Neuhegelianismus zu bewähren suchte, bemühte sich die stark ontologisch orientierte Schülergeneration: Wolfgang Cramer (1901–1974), Hans Wagner (1917–2000) und Erich Heintel (1912–2000), teils um eine Subjektontologie und eine ‚Theorie des Absoluten‘ (Wolfgang Cramer), teils um Vermittlungen zwischen dem Kantianismus, der Ontologie, der Phänomenologie und dem spekulativen Idealismus (Hans Wagner und Erich Heintel). Obwohl Wolfgang Cramer seit 1949 nur als Privatdozent, apl. Prof. und ao. Prof. (1962) in Frankfurt am Main wirkte, hat er, ebenso wie die beiden Großordinarien Heintel (seit 1960 in Wien) und Wagner (seit 1961 in Bonn), die Transzendentalphilosophie der Nachkriegszeit entscheidend geprägt. Aus heutiger Perspektive fällt es allerdings schwer diese Prägung positiv zu bewerten, denn registriert man überblicksmäßig die „Richtungen [...], die den Bereich des für philosophisch relevant Gehaltenen besetzt halten“, die analytische Philosophie, die Hermeneutiker, die Frankfurter Schule, die sich „als katholisch verstehende ‚Philosophie‘“, „die sog. Postmodernisten“ und die „Gruppe der primär historisch Interessierten, für die Philosophie in Tat und Wahrheit zu einer (Unter)Disziplin der Geisteswissenschaft geworden ist“, muß man nüchtern feststellen, daß die „Transzendentalphilosophie [...] nicht auf dem als sinnvoll erachteten Stichwortkatalog des etablierten Zeitgeistes“ erscheint [22. S. 1f.]. Einschränkend ist zu sagen, das Stichwort Transzendentalphilosophie erscheint zwar auch auf dem „Stichwortkatalog“ der genannten Richtungen, es erscheint dort aber jeweils unter deren Vorzeichen und somit unter spezifischen Voraussetzungen, die den prinzipientheoretischen Anspruch der Transzendentalphilosophie entweder gänzlich negieren oder unter anthropologischen und bewußtseinsphilosophischen Vorzeichen auf seine sprachanalytisch oder hermeneutisch oder diskurstheoretisch rekonstruierbaren Aspekte reduzieren.
Dennoch nennt Harald Holz an anderer Stelle eine Reihe transzendentalphilosophischer Gegenentwürfe: „Jüngste Entwürfe, die u. a. auch auf die Überwindung der beschriebenen Problemverengungen abzielen, wurden von W. Flach, H. Holz, P. Rohs, H.-D. Klein, W. Marx und K. W. Zeidler vorgelegt.“ [23. S. 763] Unter streng systematischem Aspekt verdienen vor allem die gegenläufigen Entwürfe von Werner Flach (1930–2023) und Harald Holz (geb. 1930) Beachtung. Werner Flach setzt im Anschluß an seinen Lehrer Hans Wagner und in steter Vergegenwärtigung der Kantischen Erkenntnislehre die geltungstheoretische und urteilslogische Linie der Kantinterpretation und – nachfolge fort, die über Bruno Bauch an Heinrich Rickert und über Lotze an den deutschen Idealismus und dabei insbesondere an die Fichtesche Prinzipientheorie anknüpft. Er begreift „das ganze Kantische Lehrgebäude als Ausformung des Gedankens der Letztbegründung“ [24. S. 15] und „rein geltungstheoretische Argumentation“ [24. S. 34], die, „der Idee der Transzendentalphilosophie“ gemäß, auf „Sicherheit bezüglich der Verfassung und des Ganges der Wissenschaft, der positiven Wissenschaften und der von diesen klar und deutlich unterschiedenen wie mit ihnen zusammenhängenden Grundlegungswissenschaft“ zielt [24. S. 193]. Das systematische Hauptwerk, die Grundzüge der Erkenntnislehre, umfaßt dieser Zielsetzung entsprechend Erkenntniskritik, Logik und Methodologie, wobei Flach die Erkenntnislehre als „Fundamentalphilosophie“ oder philosophia prima versteht [25. S. 93f., 130], da sie im Gegensatz zu allen „nichtoder pseudotranszendentalen Begründungsgedanken“ [25. 117], „den Grund aller und jeder Erkenntnis nicht in einem sachlich Letzten, sondern einzig und allein in der Bestimmtheit [sucht], die alle und jede Erkenntnis überhaupt zur Erkenntnis, d.i. zu notwendig geltungsdifferentem Wissen, macht, einer rein formalen (strukturalen) Bestimmtheit, der Struktur des Urteils, und darüber hinaus in den konstitutiven Momenten dieser Struktur.“ [25. S. 112f.] Die Erkenntniskritik [25. S. 133–246] entfaltet ein „funktionale[s] Modell des Wissens in seiner Geltungsbestimmtheit“ [25. 143ff.], wobei Flach in diesem Zusammenhang betont, daß ontologische und bewußtseinstheoretische Überlegungen „kein Beitrag mehr zur Aufklärung der Geltungsbestimmtheit des Wissens“ sind. Darum ist die Erkenntniskritik an der Bewußtseinsthematik und „an dem Fortgang zur Ontologie nicht interessiert. Sie stellt deren Thematik als Anschlußthematik hin; sie nimmt sie aber selbst nicht auf.“ [25. S. 211, 223f.] Die Logik [25. S. 247–353] ist „in ihrem ersten, grundlegenden Stücke“, der „Lehre von den erkenntniskonstituierenden Prinzipien“ [25. S. 264ff.], mit dem dreifachen Problem, einer prinzipientheoretischen Charakteristik der drei Urteilsglieder (Urteilssubjekt, Urteilsprädikat und Urteilsrelation) konfrontiert, die Flach anhand des Prinzips der Identität, des Prinzips des Widerspruchs und des Prinzips der Dialektik vornimmt. Ihren Abschluß findet die Erkenntnislehre in der Methodenlehre [25. S. 355–687], die – in ausführlicher Auseinandersetzung mit den maßgeblichen wissenschaftstheoretischen Positionen des 20. Jahrhunderts – die methodologische Funktion des regulativen Apriori anhand der Unterscheidung von universalen, speziellen und spezifischen Methoden zu einer detaillierten Theorie der Methodenbestimmtheit der wissenschaftlichen Erkenntnis ausbuchstabiert. Die Ideenlehre vervollständigt die Erkenntnislehre zur „philosophischen Systematik“, denn nachdem „die Philosophie qua philosophia prima Erkenntnislehre ist“, sind die in den Grundzügen der Ideenlehre skizzierten ethischen, ästhetischen und ökonomisch-sozialen „Themen der Selbstgestaltung des Menschen und seiner Welt, der Kultur“, als Themen der philosophia secunda zu verstehen [26. S. 10f.].
Während Flach die Transzendentalphilosophie im Lichte der transzendentalen Analytik und der neukantianischen Interpretation primär als Theorie der Gegenstandsbestimmung versteht (so daß ihm die Ideenlehre bezeichnenderweise zur philosophia secunda wird), geht Harald Holz der Sache nach von der Ideenlehre aus, da er „einen Primat des Synthesis-Modells“ bzw. „eine transzendentale Theorie konstitutiver Relationalität“ vertritt, die nicht „primär und allein auf die ihre Gründe erhellende Reflexion konstitutiver Gegenständlichkeit“ zielt [27. S. 113f.]. Holz hat sich den Zugang zur Transzendentalphilosophie im Horizont der katholischen Philosophie und der neo-ontologischen Kantinterpretation (Gottfried Martin) mit Blick auf eine Theorie des Absoluten erschlossen. Auch nachdem die spezifisch christlichen Lehrinhalte für ihn ihre Verbindlichkeit verloren haben, bestimmt der vor allem durch den späten Fichte und Schelling (unter den Neueren durch H. Wagner und W. Cramer) vermittelte Zugang, sein Verständnis der Transzendentalphilosophie, insofern Holz seine Denkbemühungen auf einen strikt formal gefaßten aber gleichwohl generativen Begriff des Absoluten[6] konzentriert und, „in der Intensität Fichte nicht unähnlich, immer wieder und in immer neuer Darstellungsweise“ versucht [28. S. 182], eine ursprüngliche synthetische Einheit oder fungierende Identität [27. S. 295] oder „sich selbst erzeugende Relation“ [29. S. 19] herauszuarbeiten, indem er den kontraskeptischen Inversionsschluß (Augustinus, Descartes), den aristotelischen Grundsatz vom ausgeschlossenen Widerspruch und das Anselmsche Argument in ein Argument zusammendenkt. Demzufolge sind der kontraskeptische Inversionsschluß nicht nur im Sinne einer (Transzendental-)Pragmatik als unabdingbare Voraussetzung des Diskurses und der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch nicht nur als Voraussetzung jeder formallogischen Beweisführung in Ansatz zu bringen, sondern Holz versucht, „die auch in der formallogisch sich artikulierenden Begrifflichkeit eines (ersten) Grundsatzes sich darstellende Ausdrucksform der letzthin allbestimmenden Notwendigkeit an sich zu finden“ [22. S. 87], um eine „Fundamentallogik von erklärtermaßen transzendentalsystematischem Zuschnitt“ zu etablieren [22. S. 89], die, wie sowohl das einschlägige Hauptwerk (Allgemeine Strukturologie), wie auch eine Fülle von Einzeluntersuchungen belegen, auf den unterschiedlichsten Problemfeldern ihre Anwendung findet.
Die Arbeiten von Flach und Holz zeichnen sich dadurch aus, daß sie den prinzipientheoretischen Anspruch der Transzendentalphilosophie als strikt (transzendental-)logisches Problem verstehen, wobei die Gegenläufigkeit ihrer Ansätze auf das spekulative Problem einer Vereinbarung von Kategorienlehre (Analytik) und Ideenlehre (Dialektik) verweist. Werfen wir noch einen Blick auf Ansätze, die unter bewußtseinsphilosophischen Vorzeichen den prinzipientheoretischen Anspruch der Transzendentalphilosophie auf seine sprachanalytisch oder hermeneutisch oder diskurstheoretisch rekonstruierbaren Aspekte reduzieren, so sind die beiden prominentesten Positionen zu nennen, die Ende des 20. Jahrhunderts beanspruchten, einen transzendentalen Ansatz zu vertreten: die Transzendentalpragmatik von Karl-Otto Apel (1922–2017), sowie die „Heidelberger Schule“ um Dieter Henrich (1927–2022), zumal Apel – wenngleich nur in beiläufiger Bezugnahme [30. S. 167–196] – die Sprachphilosophie und Nominalismuskritik Erich Heintels und Henrich die Subjektontologie Wolfgang Cramers ([31. S. 237–263] und [32. S. 188–232]) fortführt. In der Idealismusforschung und Selbstbewußtseinstheorie Dieter Henrichs und seiner Schule begegnen die systematischen Interessen der Transzendentalphilosophie, insbesondere der idealistischen Kantnachfolge, denen der Phänomenologie und der analytischen Philosophie, wobei sich die Diskussionen auf das Zeitproblem und das ‚Phänomen‘ Selbstbewußtsein zentrieren. Bei aller philologischen Akribie und dem analytischen Scharfsinn der einschlägigen Untersuchungen, ist festzustellen, daß sie sich mehr an kanonischen Texten und Autoren und deren Umfeld, sowie an den eigenen bewußtseinstheoretischen Vorentscheidungen, als an prinzipientheoretischen Fragen orientieren, zumal Henrichs Selbstbewußtseinstheorie eher darum bemüht scheint, sich in paralogistischen Problemverschiebungen zu verlieren, als ihnen auf den Grund zu gehen. Während Henrich und seine Schüler in detailreichen Studien mit einem umfangreichen und differenzierten Arsenal an philologischen Beweisgründen Idealismusforschung und Selbstbewußtseintheorie betreiben, pflegt Karl-Otto Apel einen vergleichsweise distanzierten Umgang mit der klassischen Transzendentalphilosophie, der er, weil er sie als Selbstbewußtseintheorie versteht, eine semiotische und diskurstheoretische ‚Transformation‘ verordnet. Der Nominalismuskritik, die Apels sprachhermeneutischen und pragmatischen Ansatz (und seine Affinität zu Hegel und Peirce, den beiden großen Anti-Nominalisten der neueren Philosophie) motiviert, wird unter linkshegelianischen Vorzeichen in eine Kritik des „methodischen Solipsismus“ verkehrt, der seit „Ockham und Descartes […] die philosophische Erkenntnistheorie irregeführt“ habe [30. S. 60]. Der Rekurs auf das „apriorische Faktum der Argumentation“ und die nicht ohne „performativen Selbstwiderspruch“ zu negierenden Voraussetzungen des Diskurses, bietet jedoch keinen Ersatz für die transzendentallogische Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit jeder Argumentation, vor allem vermag der Hinweis auf ein „apriorisches Faktum“ nicht, den Nominalismus zu entkräften, der sich an seine „empirischen Fakten“ hält und daran auch genug hat, solang er jede Frage nach nicht bloß empirischen Voraussetzungen seiner „empirischen Fakten“ mit Ockhams Rasiermesser abschneiden kann. Dem Nominalismus ernsthaft begegnen kann allenfalls ein Unterfangen, das er denn auch energisch und mit anhaltendem Erfolg als metaphysischen Obskurantismus perhorresziert: eine Onto-Logik bzw. ein „objektiver Idealismus“,[7] der den einseitig an den Erkenntnisresultaten (den „Gegenständen“ der Erkenntnis) orientierten Anschauungsund Erfahrungsbegriff des Nominalismus, sowie sein entsprechend einseitiges urteilsund subsumtionslogisches Begriffsverständnis radikal in Frage stellt.
Die Frage nach einer „Wiederbelebung der systematischen Transzendentalphilosophie“ ist folglich im Rückblick auf die Problementwicklungen der letzten 100 Jahre kurz dahingehend zu beantworten, daß sich die Transzendentalphilosophie auf die synthetische Methode der Vernunftkritik zu besinnen hat, die „nichts als gegeben zum Grunde legt, außer die Vernunft selbst“, daß sie also, mit Kant über Kant hinausgehend, nicht primär Theorie irgendeines ‚Gegenstandes‘ oder Gegenstandsgebietes, sondern logische Selbstexplikation der Vernunft sein muß, die sich als Dialektik freilich auch als Grundlegung der Analytik und damit jeglicher Gegenstandsbestimmung wird beweisen müssen.
1 Vgl. K. W. Zeidler, Grundriß der transzendentalen Logik, Cuxhaven 1992, 1997, 3. erg. Aufl. Wien 2017; Michael Wolff, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel. Mit einem Essay über Freges Begriffsschrift, Fft/M. 1995; Martin Bunte, Erkenntnis und Funktion. Zur Vollständigkeit der Urteilstafel und Einheit des kantischen Systems, Berlin 2016.
2 B. Bauch, Immanuel Kant (Sammlung Göschen, Geschichte der Philosophie V), Leipzig 1911, Berlin-Leipzig 1916, 1920; ders., Immanuel Kant, Berlin-Leipzig 1917, 1923; vgl. [15. S. 188f.]
3 „Mit allen diesen noch sehr zu vertiefenden Untersuchungen […] mögen wir ja nun besonders ganz in die Bahnen Fichtes und Hegels wieder einzulenken […]. Aber doch gehen wir mit jenen nicht weiter zusammen, als schon sie die Forderungen, die in dem Grundgedanken der transzendentalen Methode uranfänglich lagen, aber durch Kant selbst offenbar nicht erfüllt waren, ihrerseits zu erfüllen bestrebt gewesen sind.“ [21. S. 210].
4 Schon Ernst Cassirer und Martin Heidegger, die beide in engstem Kontakt zu Paul Natorp gestanden hatten, haben in der ‚Davoser Disputation‘ (1929) an der Forderung und darum auch aneinander vorbeigeredet. Dazu [1. S. 35–43].
5 Vgl. die Diskussion in Ch. Krijnen/K. W. Zeidler (Hrsg.), Wissenschaftsphilosophie im Neukantianismus, Würzburg 2014, zwischen Christian Krijnen (S. 11–56), Werner Flach
(S. 117–129) und Kurt Walter Zeidler (S. 85–116).
6 „ein Absolutum strikt formaler Art, allerdings modaliter von einer Notwendigkeit, die ihre eigene Wirklichkeit unmittelbar einschließt“ [22. S. 82].
7 Bezeichnenderweise ist der Apel-Schule im Zeichen eines objektiven Idealismus Kritik aus ihren eigenen Reihen erwachsen [33. S. 142ff.].
About the authors
Kurt W. Zeidler
University of Vienna
Author for correspondence.
Email: kurt.walter.zeidler@univie.ac.at
ORCID iD: 0009-0009-7275-3718
PhD in Philosophy, Full Professor, Institute of Philosophy
7/III Universitätsstraße, Vienna, A-1010, AustriaVladimir N. Belov
RUDN University
Email: belov_vn@pfur.ru
ORCID iD: 0000-0003-3833-6506
SPIN-code: 4922-3611
PhD in Philosophy, Professor, Head of the Department of Ontology and Epistemology, Faculty of Humanities and Social Sciences
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian FederationAlexandra S. Perepechina
RUDN University
Email: perepechina_as@pfur.ru
ORCID iD: 0000-0002-3226-1040
Head Teacher, Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian FederationReferences
- Kant I. Prolegomena to any future metaphysics that may arise as a science. Moscow: Sotsekgiz; 1937.
- Rickert H. Alois Riehl. Logos XIII/1924f.
- Levy H. Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus. Charlottenburg: Pan-Verlag; 1927.
- Rickert G. Philosophy of life. In: Heinrich Rickert Philosophy of Life. Kiev: Nika-center publ.; 1998.
- Kroner R. Von Kant bis Hegel. Bd. 2: Von der Naturphilosophie zur Philosophie des Geistes. Tübingen: J.C.B. Mohr; 1924.
- Windelband W. Präludien. Bd. 2. Tübingen: J.C.B. Mohr; 1919.
- Ebbinghaus J. Relativer und absoluter Idealismus. Historisch-systematische Untersuchung über den Weg von Kant zu Hegel. Leipzig: Voß; 1910.
- Kroner R. Hegel heute. In: Hegel-Studien. Bd. 1. Bonn: Bouvier; 1961.
- Ebbinghaus J. Kantinterpretation und Kantkritik. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 2/1924.
- Ebbinghaus J. Rezension von K. Reich, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel. Deutsche Literaturzeitung. 1933.
- Ebbinghaus J. Kantinterpretation und Kantkritik. 2. erweiterte und verbesserte Fassung. In: Gesammelte Aufsätze, Vorträge und Reden. Hildesheim: Georg Olms; 1968.
- Kant I. On one discovery, after which any new criticism of pure reason becomes superfluous due to the presence of the former (Against Eberhard). Kantovskij sbornik. 1991;(16):151.
- Pichler H. Über Christian Wolffs Ontologie. Leipzig: Dürr; 1910.
- Heimsoeth H. Zur Geschichte der Kategorienlehre. In: Heimsoeth H, Heiß R, hrsg. Nicolai Hartmann. Der Denker und sein Werk. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1952.
- Wagner H. Zur Kantinterpretation der Gegenwart. Rudolf Zocher und Heinz Heimsoeth. Kant-Studien. 53/1961f.
- Wundt M. Kant als Metaphysiker. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Philosophie im 18. Jahrhundert. Stuttgart: Enke; 1924.
- Marx W. Identität als dialektisch konstruierbare Totalität und als Hypothese der Fundierung wissenschaftlicher Geltung. Überlegungen zur Theorie des Begriffs bei Hegel und Cohen. In: Gadamer H-G, hrsg. Stuttgarter Hegel-Tage 1970 (Hegel-Studien, Beiheft 11). Bonn: Bouvier; 1974.
- Tenbruck F. Heinrich Rickert in seiner Zeit. Zur europäischen Diskussion über Wissenschaft und Weltanschauung. In: Oelkers J, Schulz WK, Tenorth H-E, hrsg. Neukantianismus. Kulturtheorie, Pädagogik und Philosophie. Weinheim: Deutscher Studien Verlag; 1989.
- Zeidler KW. Das Problem der metaphysischen Deduktion im ausgehenden Neukantianismus (2000). In: Provokationen. Zu Problemen des Neukantianismus. Wien: Ferstl&Perz; 2018.
- Lask E. Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre (1911). In: Gesammelte Schriften. 2. Bd. Herrigel E, hg. Tübingen: J.C.B. Mohr; 1923.
- Natorp P. Vorlesungen über praktische Philosophie. Erlangen: Verlag der Philosophischen Akademie; 1925.
- Natorp P. Kant und die Marburger Schule. Kant-Studien. 17/1912.
- Holz H. Immanente Transzendenz. Würzburg: K&N; 1997.
- Holz H. Transzendentalphilosophie. In: TRE (Theologische Realenzyklopädie) XXXIII. Berlin: Walter de Gruyter; 2002.
- Flach W. Die Idee der Transzendentalphilosophie. Würzburg: K&N; 2002.
- Flach W. Grundzüge der Erkenntnislehre. Erkenntniskritik, Logik, Methodologie. Würzburg: K&N; 1994.
- Flach W. Grundzüge der Ideenlehre. Würzburg: K&N; 1997.
- Holz H. System der Transzendentalphilosophie im Grundriß. Bd. 1. Freiburg-München: Alber; 1977.
- Engstler A, Klein H-D, hg. Perspektiven und Probleme systematischer Philosophie. Harald Holz zum 65. Geburtstag. Fft/M u.ö.: P. Lang; 1996.
- Holz H. Allgemeine Strukturologie. Entwurf einer Transzendentalen Formalphilosophie. Essen: Die Blaue Eule; 1999.
- Apel K-O. Transformation der Philosophie. Bd. 1. Fft/M: Suhrkamp; 1973.
- Henrich D. Über System und Methode von Cramers deduktiver Monadologie. Philosophische Rundschau. 6/1958.
- Henrich D. Fichtes ursprüngliche Einsicht. In: Subjektivität und Metaphysik. Festschrift für Wolfgang Cramer. Henrich D, Wagner H, hrsg. Fft/M: Vittorio Klostermann; 1966.
Supplementary files