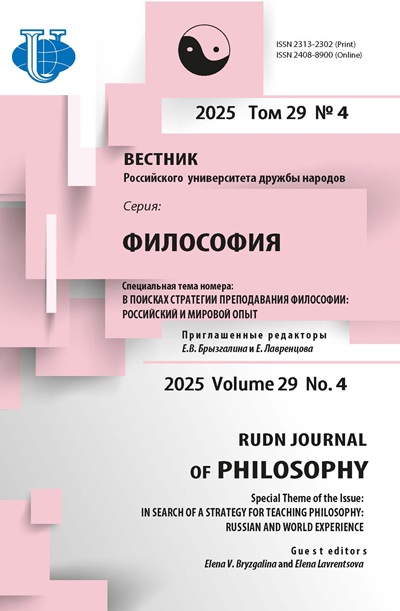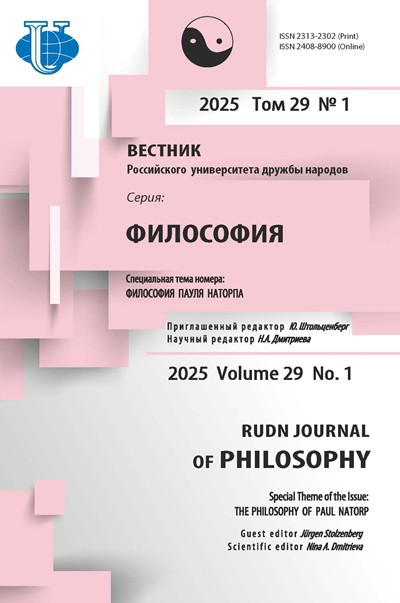Lecture on Paul Natorp and Hermann Cohen in Marburg 1948
- Authors: Hartmann N.1, Wiedebach H.1
-
Affiliations:
- Issue: Vol 29, No 1 (2025): THE PHILOSOPHY OF PAUL NATORP
- Pages: 148-156
- Section: THE PHILOSOPHY OF PAUL NATORP
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/43536
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2025-29-1-148-156
- EDN: https://elibrary.ru/GAEQUS
- ID: 43536
Cite item
Full Text
Abstract
Nicolai Hartmann delivered the lecture on Hermann Cohen and Paul Natorp, published here for the first time, in 1948 in Marburg. He had studied under both scholars since 1905 and had begun his academic career there. However, in his later works Hartmann distanced himself from the thought of his former mentors. Therefore, this late lecture seems all the more striking. In his speech, he draws an impressive portrait of the two personalities, especially of Natorp. Alongside conceptual sketches of their thinking, he shares insights into their personal style in the lectures and seminars they taught.
Keywords
Full Text
Vorbemerkung des Herausgebers
Im Juni 1948 reiste Nicolai Hartmann (1882–1950) zu dem hier erstmals publizierten Vortrag nach Marburg. Er hatte dort seit 1905 vor allem unter Hermann Cohen und Paul Natorp Philosophie studiert. Beide förderten ihn in hohem Maß. 1907 war er promoviert, 1909 habilitiert worden. 1920 wurde er außerordentlicher, 1923 als Nachfolger Natorps ordentlicher Professor. Sein Denken unterschied sich jedoch in Stil und Inhalt zunehmend von den Arbeiten der beiden Lehrer. Ihr Werk spielte fortan eine eher marginale Rolle. Der späte Vortrag über Cohen und Natorp ist daher ungewöhnlich, geradezu ein Solitär.
Hartmann hielt ihn am 9. Juni 1948 im Alter von 66 Jahren, knapp zwei Jahre vor seinem Tod am 9. Oktober 1950. Hinweise auf seine Vorbereitung gibt es im Schriftwechsel mit Heinz Heimsoeth [1].[1] Hartmanns erste Mitteilungen und Anfragen oder ein Bericht im Nachgang des Vortrages liegen leider nicht vor. Daher kommen nur einige Briefe Heimsoeths in Frage.
Etwa Anfang März 1948 scheint ihm Hartmann von einer Einladung erzählt zu haben. Heimsoeth antwortet am 12. März: „daß Du einen Cohen-Natorp-Vortrag in Marburg halten wirst, ist auch etwas in sich Gutes – Gedenken und Rückbetrachten, nachdem alle Auseinandersetzung (freilich auch leider aller genius loci) weit zurückliegt und schon wie verklungen ist. […] Schön, daß Du das alles noch bewältigen kannst, wenn auch mit Anstrengung u. einiger Sorge“ [1. S. 1055]. Knapp drei Wochen vor dem Marburger Auftritt, am 20. Mai 1948, schreibt er seinem Freund sodann einiges zur „Ankurbelung und Wiederbelebung von lange Vergessenem“ [1. S. 1061]. Im Blick auf das konkrete Ereignis vermutet er: „Man erwartet das Bild zweier verehrungswürdiger philos. Persönlichkeiten, ihrer gemeinsamen Absichten und ihres Schulwirkens. – Mehr Gedenkrede als Untersuchung, – sollte ich meinen. Schön wäre viell., zu betonen, wie sehr die Kant-Parole und die große Hingegebenheit an Kant-Texte doch den Weg selbständigen Vorgehens freigab (und faktisch ja eröffnet hat, – für Dich z.B.). Schwer ist die Aufgabe gewiß. Eben wegen der von heute aus gesehen – doch sehr befremdlichen Abstraktheit des ganzen Tuns. Wie fern liegt das zurück (besonders nun eben für Dich!). Möchte es Dir gelingen, Dich an den Fäden der in Dir waltenden Kontinuität zurückzubesinnen auf das, was an Leben in dem ganzen Mühen und Verkünden und Schuldisputieren damals war.“ [1. S. 1061].
Eine Anlage zu diesem Brief unter dem „Leitthema: Größe und Grenze dieser beiden Philosophen und ihrer Schulwirkung, im Rahmen des philosophischen Lebens jener Generation“ benennt eine Reihe systematisch-historischer Gesichtspunkte und Literatur [1. S. 1063–1065]. Dafür hat sich Hartmann offenbar noch vor seinem Auftritt bedankt. Heimsoeth antwortet am 5. Juni: „Lieber Nic, ich freue mich, daß meine dürftigen Bemerkungen zum Marburger Thema nicht ganz unnütz für Dich waren. Möchte der Vortrag schön und harmonisch ablaufen im alten Marburg. Es ist doch sehr schön. daß Du der beiden Alten dort einmal gedenkst. Etwas Ehrwürdiges bleiben sie ja in unserem Leben, soviel auch von den Inhalten verblaßt und auch vergessen sein mag. Es war ja wohl noch letztes Epigonentum, aber von echter Idealität. Und im Ganzen noch ein geistiges Geborgensein vor der Krise“ [1. S. 1065].
Im großen ganzen stimmt Hartmann dem zu. Nur an der „Geborgenheit“ jener Zeit zweifelt er. Als Heimsoeth am 26. Oktober über sein eigenes „Bewußtsei[n] der Geborgenheit“ spricht [1. S. 1081], gedenkt Hartmann noch einmal der beiden Lehrer: „Ich verstehe heute den alten Cohen besser darin als einst: ihm war dieses Bewußtsein ein für allemal verloren gegangen, und niemals hat er es wiedergefunden; rechts und links sah er Feinde, Neider, Gegner aller Art. Ob mit Recht, konnte er nicht mehr unterscheiden. Und dabei lebte er in dem Glauben, die Wahrheit zu haben, einsam wie ein Prophet unter Ungläubigen. Wie glücklich war Natorp dagegen, der in seiner Unschuld den Neid nicht sah! Wie glücklich sind wir – mit der reichen Anerkennung, die wir erfahren, – der verdienten und der unverdienten“ [1. S. 1082] (30.10.1948).
Der folgende Text wurde nicht von Hartmann selbst geschrieben, sondern ist ein „Bericht“ von Natorps ältester Tochter Annemarie Happich. Ob sie Notizen Hartmanns nutzen konnte, ist unbekannt. Daß es jedoch irgendeine Vorlage, möglicherweise ein (stenographisches?) Vortragsprotokoll gab, liegt angesichts der differenzierten Ausführungen nahe.
Gleichwohl läßt sich deren Qualität nicht abschließend beurteilen. So klingt es mindestens merkwürdig, wenn man die „geschichtliche Perspektive“, aus der Hermann Cohen zu seiner Logik der reinen Erkenntnis gelangt sei, so benennt: „Der Ursprung alles Lebens, also auch z.B. des Denkens, liegt jenseits der menschlichen Begriffsmöglichkeit“ (Vortrag S. {3}). Geradezu auffällig unrichtig scheint etwa die Behauptung, Cohen habe den im „‘Ursprung’ […] gesuchten Grund auch ‘Phänomen’“ genannt (Vortrag S. {4}).
Ob dergleichen von Hartmann selbst oder erst in unserem Bericht so formuliert wurde, muß offenbleiben. Jedenfalls liegt hier eine Grauzone der genauen Deutung, damit aber auch eine Grenze für den Sinn editorischer Detailkritik. Auf solche Anmerkungen habe ich daher verzichtet. Der Bericht zeigt eindrücklich, wie sich Hartmanns Erinnerung an die frühen Marburger Lehrer zu ehrwürdigen Denkbildern verdichtet hat. Sichtlich mehr noch als Cohen war vor allem Paul Natorp für ihn eine philosophisch prägende Gestalt.[2]
Der Text liegt als Typoskript im Durchschlag vor: 3 Blätter im Format DIN A 4, beidseitig auf 5 Seiten in einzeiligem Abstand sauber getippt, mit vereinzelten handschriftlichen Korrekturen. Er wurde Anfang 1974 von Gusta Knittermeyer, der Frau Hinrich Knittermeyers, an Helmut Holzhey in Zürich geschickt (er antwortete am 4.3.1974) und mir von Letzterem zur freien Verwendung überlassen, wofür ich freundlich danke.
Der Abdruck enthält die Seitenzählung des Originals in geschweiften Klammern {…}. Die sehr wenigen Tippfehler wurden stillschweigend korrigiert.
[Der Vortrag]
Annemarie Happich: Bericht nach einem Vortrag des Professors Dr. Nikolai Hartmann, Göttingen, über Hermann Cohen und Paul Natorp am Mittwoch, dem 9.6.1948, im Auditorium maximum des Landgrafenhauses in Marburg/Lahn.
Von der Größe und den Grenzen dieser Philosophen soll die Rede sein. Ihre geistige Energie und sittliche Lauterkeit hat zündend und suggestiv einst die besten und selbständigsten Köpfe aus vielen Ländern angezogen. Die Bedeutung ihres Schaffens hat ihren Grund in ihrem hohen Sozialethos und in der Strenge der wissenschaftlichen Logik, durch welche sie den Ansatzpunkt zu ihrer Arbeit suchten, fanden und festhielten. Dieser Ansatzpunkt waren die Kantischen Gesetze der Philosophie, aber Cohen und Natorp erkannten und lehren diese Gesetze in tieferer und feinerer Zuspitzung, als sie Kant selber schon bewußt geworden waren. Auch die Tendenz, die in Cohens und Natorps Arbeiten verborgen lag, geht über das von ihnen selbst Geschaffene hinaus und stellt ihren ehemaligen Schülern und ihren Nachfolgern hohe und weite Aufgaben für die eigene Forschung. Das war Cohen und Natorp im Gegensatz gegen die Historiker ihrer Zeit sonnenklar. Beider Blick war in der Geschichtsforschung nicht auf das Gewollte der alten Meister, sondern auf ihr Geschautes und in der tieferen Wirklichkeit Geschaffenes gerichtet. Diese Richtung der beiden Freunde war schon in ihrem Schaffen lebendig wirksam, ehe sie es spruchreif der Welt der Gelehrten verkünden konnten. Dies letztere geschah erst, nachdem der „Historismus“ aufgekommen war; aber sie taten schon lange vorher, was Leibniz inbezug auf die Forschung mit den schönen Worten bezeichnet hatte: „Das Gold aus dem Staube heben“. Weil Cohen und Natorp in die Tiefe gruben und das Gold suchten, statt den Staub, der vor aller Augen liegt, zu beschreiben, blieben sie unpopulär. Sie wurden leider auch in der Marburger Universität, wo ein Gelehrter sie hätte erkennen müssen, verkannt. Sie wurden – sogar auch in Marburg – verlästert.
Der Vortrag nun soll in groben Zügen einen Hinweis geben, daß man Cohen und Natorp wieder kennen lerne. In der wissenschaftlichen Arbeit eines jeden von ihnen können zwei Perioden festgestellt werden.
Die erste Periode beider ist im ganzen treffend mit dem Namen Kant zu überschreiben möglich. In seinem Namen traten sie zuerst, jeder einzelne für sich und später gemeinsam, gegen den Historismus, Psychologismus, Materialismus und Monismus auf und auch gegen den Idealismus Hegels, weil sie auch diesen als spekulativ und als nicht wissenschaftlich genug erkannten. Sie kämpften in ihrer edlen, gerechten und gütigen Art, aber in scharfer Klarheit gegen die Kantianer ihrer Zeit: gegen Vaihinger, Adickes usw., ja, auch gegen Dilthey, der ihrem Wesen und Denken sonst nicht ferne stand. Es ging beiden um den Begriff des „Transscendentalen“, des „Gewissen“, des „Dialektischen“ und wie sie es sonst noch nannten. Cohen und Natorp erkannten und lehrten beide – jeder in seiner streng logischen, bis ins letzte fragenden Art: Es bedarf zur Transscendenz keines Überbewußtseins, welches von dem rein wissenschaftlichen Denken unterschieden oder ihm gar entge-{2}gengesetzt wäre. Allerdings genügt zum transscendentalen – Sie können auch sagen „zum religiösen“ – Wissen nicht die Erfahrung des Individuums, der „einzelnen Menschen“. Der Sinn alles dessen, was da ist und geschieht, der Geist, der es schafft, erhält, durchdringt und weiterführt, wird nur in dem Allen, im Gemeinsamen, im ganzen Leben, also in der ganzen Geschichte und in der ganzen Wissenschaft gewußt und erkannt; denn Wahrheit kann auf die Dauer nicht gegen Wahrheit bestehen, und glaubte man sie als Einzelner im einzelnen Erlebnis oder als einzelne Gemeinschaft noch so tief erlebt zu haben. Das Leben ist allen und allem, was lebt, gemeinsam. Es wird durch die Jahrtausende hindurch von der Gesamtheit der Menschen erlebt und durch alle wissenschaftlichen Einzelerkenntnisse und Systeme hindurch erforscht, und alle Einzelnen und alle einzelnen Erkenntnisse fallen dahin, soweit sie nur Sandkörner sind im Wege des ganzen Bewußtseins derj[enigen] Wissenschaft, welche schaffend bleibt, weil sie aus dem Ganzen schöpft.
Bei Cohen ist das Problem, um das es ihm wie auch Natorp ging, dieses geschichtliche gemeinsame Bewußtsein. Das heißt ihm das Transscendentale, welches das Bewußtsein einzelner Menschen, Gemeinschaften und Zeiten übersteigt und in sich faßt. Darum durchforschte er gerade solche Wissenschaftssysteme, die sich gegeneinander widersprachen. Er deckte die Verwandtschaft zwischen Plato und Kant auf. Die Zurückführung alles wissenschaftlichen Forschens auf die von Kant erarbeitete Erkenntnis brachte ihm und auch Natorp den Vorwurf des Rationalismus ein. Cohen aber zeigte in der Untersuchung und Verbindung von Platos Ideenlehre und der mathematischen Wissenschaft die „Idee“ nicht als je oder niemals erreichtes Ziel, sondern als Prinzip, als „Idealprinzip“, also als Urgrund und Urbeginn und fortlaufende Urbestimmung alles Erkennens auf, – so Natorp mit ihm und klarer bewußt als er –, und ihre Erkenntnis haben ihre Gegner nicht wahr haben wollen.
Natorp trat schon in der ersten Periode seiner Lebensarbeit in die Untersuchungen über den Ideenbegriff ein, welche Cohens zweite Periode bezeichnen. Natorps erstes großes Werk heißt „Platos Ideenlehre“. Seit Schleiermacher bis dahin waren Platos Werke nur philologisch erforscht und gelehrt worden, nur inbezug auf die Frage, wann die einzelnen Schriften Platos entstanden seien. Natorps Buch ist die erste wahrhaft philosophische Darstellung des Philosophen Plato. Es enthält die erste Erschließung des späteren Plato; denn der Sinn des Buches Parmenides und damit zum erstenmal das Wesen der ganzen platonischen Philosophie wurde zum erstenmal in der ganzen Geschichte der Wissenschaft von Natorp entdeckt. Ein Buch, das so schwierig und so abgründig verfaßt ist und dabei so eilend und so unvollendet von einer Frage und Erkenntnis immer zur nächsten drängt, das immer unvollendet bleibt und unvollendet abbricht, ein solches Buch wie Platos Parmenides zu lesen und zu interpretieren, dazu gehörte nicht nur gründliche Gelehrtheit, sondern Kongenialität. Paul Natorp hatte sie. Er lebte {3} in kongenialer Problemtiefe mit Plato. Die Folge war, daß alle weniger genialen Philosophen seiner Zeit in heftige Polemik gegen Natorps Buch gerieten und dieser Kampf jahrzehntelang tobte; vielleicht ist er auch heute noch nicht zu Ende geführt.
Natorps Schüler aber mussten lesen lernen wie er. Ja, sie mussten werden wie er, zum mindesten mussten sie erfahren, welche sehr hohe Anforderungen an sich selbst sie stellen und erfüllen mußten, um auch nur eine Seite Plato mit Natorp, unter Natorps Leitung, lesen zu lernen. Ähnlich ging es bei Cohen zu; z.B. kam es häufig vor, daß er in einem Semester in der zweistündigen Seminarübung der Woche nur wenige Seiten bearbeiten ließ. Diese waren dann aber richtig gelesen, und alles, was auf der Universität anders geübt wurde, fiel als Stümperei dagegen ins Nichts.
Neben solchem Plato-Lesenlernen hielt Natorp auch „systematische Übungen“. Jede solche Übungsstunde begann damit, daß er selber die kurze Zusammenfassung seiner letzten Vorlesung gab. Als zweites Unternehmen stellte er, der Professor, die Frage nach der Stellungnahme der Studenten. Sie mussten sagen, an welcher Stelle der Vorlesung sie ihr eigenes Weiterdenken einsetzen und gegen welche sie selbständige Einwendungen erheben konnten. Danach rief Natorp 3. in größter Sachlichkeit zum Angriff gegen seine eigenen Worte auf. Selber immer noch forschend, immer noch sein schon Erkanntes von neuen Gesichtspunkten her prüfend, immer aus laufender, vordringender Arbeit heraus war Natorp nichts lieber, als wenn er dem Schüler Zweifel und Widerspruch zum Beginn ganz eigenen Denkens werden lassen konnte. Schon das halbe Wort griff er mit unendlich gütigem und vollendendem Verstehen auf. Auch darin war er Plato kongenial; denn was ist Sokratik?, wozu dient der Dialog im Unterricht und im Gespräch? Zum Vorwärtskommen durch den Widerspruch und Kampf und durch das Messen der Kräfte gegeneinander. Philosophie ist niemals Lehre, sondern ist Übung, ist Philosophieren. Kein Philosoph beherrsche das Denken des andern!, kein Professor das seiner Studenten! Professoren und Studenten sollen nur nach dem Einen ringen, im Kleinsten und im Größten, im Nächsten und im Blick zum Fernsten hin der Wahrheit nachzuforschen. „Herrschen“ wollten Cohen und Natorp nie.
Die zweite Periode. In ihr schuf sowohl Cohen als auch Natorp sein System. Natorp schuf es viel selbständiger, als die Gelehrten gemeinhin meinen; er schuf es auch gegen Cohen.
Cohen schrieb über die reine Logik, die reine Ethik und das reine Gefühl.
Die Logik ist für ihn die Grundlegung der ganzen Philosophie oder Metaphysik. Man kann das ontologisch, nicht nur idealistisch, auffassen. Cohen ist gegen Realismus und Idealismus gleichgültig, weil diese Begriffe zur Kategorienlehre gehören. Über die Kategorien hinaus will er das „Urteil des Ursprungs“, z.B. des Ursprungs des Denkens, erkennen. Dazu braucht er eine große geschichtliche Perspektive, und von ihr aus weiß er: der Ursprung alles Lebens, also auch z.B. des Denkens, liegt jenseits der menschlichen Begriffs-{4}möglichkeit. Dies hat Cohen nicht als Erster gefunden. In früherer Zeit nannte man diese Anschauung die „absprechende Theologie“. Über die Verneinung der Möglichkeit, den Ursprung zu erkennen, kommt ein solcher Theo-loge zum Erfassen des Nichtgefassten und Nichtfaßbaren in der Gewißheit, daß der Ursprung, aber nicht zu der Gewißheit, was er ist. So lehrt z.B. schon Cusanus: „Das Unendliche ist nicht Geheimnis“. – Cohen lehrt weiter: Realität ist nicht das Wissen der Sinne allein, sondern das Wissen des Denkens; im apriorischen Vollzug des Denkens wird das „Daseiende“, methodischen Gesetzen folgend, erst für den Menschen „da“. Dieser Gedanke lag schon der alten Atomistik nicht nur nahe, aber ganz faßbar wird er erst der hohen Mathematik. Seine Gesetze gelten für alle und alles. Dessen kann und muß jeder bewusst sein, und darum kann und muß aus dieser Gesetzlichkeit heraus auch jedermann Philosophie verstehen, wenn er sich nicht absichtlich verschließt und weder nach Wahrheit noch nach Gemeinschaft mit Menschen und allem, was da ist, fragen will. Diese Grunderkenntnis vom apriorischen Denken führt dann Cohen in allen möglichen Systemtypen durch: inbezug auf die Dinge, auf den Organismus, auf die Formen der Gemeinschaft und auf die Freiheit der Menschen, der doch von allen und allem das allerabhängigste Geschöpf sei. Cohen lehrt, der Mensch sei frei, denn Freiheit ist nicht Unabhängigkeit, sondern Selbstbestimmung im Abhängigsein.
Natorp hat die gleiche Tendenz. Er hat sie auch zuletzt nicht verlassen, sondern umgebildet. Von Anfang an lehrt er, daß „Ursprung“ nicht der rechte Ausdruck für das ist, was zum Grund des Philosophierens zurückführen soll. Cohen nannte diesen gesuchten Grund auch „Phänomen“ und Natorp ebenso schon in dem kleinen „Grundriß der Logik“. Bei Kant hieß dieses X „das Faktum der Erfahrung“ und „der transscendentale Gegenstand als X“, welches von Kant jenseits der Grenzen der Erfahrung angenommen und geglaubt wird. Natorp greift sofort das Wort „factum“ an, um es als „fieri“, also als ein immer weiteres Geschehen, umzunennen. Die Frage nach diesem in der Geschichte – so lehrt er – muß von der Vorsokratik an untersucht werden. In der Geschichte der Philosophie löst ein Problem immer das nächste ab. Also nicht einen Philosophen oder ein System gilt es in fortlaufender Reihenfolge jedesmal zu verstehen, sondern die Geschichte der Philosophie als Einheit: von Pythagoras bis Einstein und in ähnlichen Entwicklungsreihen, bis die Philosophie selber ihren Grund enthülle. Durch die Erkenntnis aber entstehe ja nicht die Erde, sondern dies, daß die Erde und überhaupt jedes Geschaffene, jedes Ding und Wesen zum „Gegenstand“ des Menschen würde. Natorp fragt weiter: Was ist Gegenstand, Gegenständlichkeit, Correlation? Sie wächst faktisch. Ursprünglich ist nur der logos. Von des logos Gewißheit aus entfaltet sich das Erkennen in Subjektivierung und Objektivierung. Diese Philosophie schien manchem dieselbe wie die von Schelling zu sein. Das ist aber falsch. Natorps System ist Phänomenerfassung.
Er drang dann weiter vor. Die „Praktische Philosophie“ enthält die Um-{5}bildung seines Systems, also nicht ein neues. Er wollte die Philosophie über das Denken, Handeln und Schaffen formulieren, dazu als Viertes die Religion als „Grenzlogik“ darstellen. In allen vier Gebieten der Tätigkeit herrscht Gesetzlichkeit der Struktur, der Funktion und des Sinns. Die Aktivität der Struktur sieht Natorp auch in der natürlichen Lebendigkeit alles Lebens. Vom Leben sagt er wie Aristoteles: „Es bewegt, wie die Liebe bewegt, und mehr“. Schöpfung stammt von oben, vom Geist, obwohl es Stufenfolgen von unten nach oben gibt. Philosophie ist Rückwendung zum Höchsten – ähnlich wie bei Plotin. Diese Rückwendung ist Grenzlogik, Theo-logie. Weil Leben vom Geiste stammt, kann Geist, Genialität, dem Sinn des Lebens begegnen. Das Beste dessen, was Geschichte schuf und erkannte, ist nicht nur geblieben, sondern in ständig andere Gestaltung aufgestiegen. Die Welt ist von Natorp nicht wie im Dualismus als minderwertig oder feindlich inbezug auf auf den Geist gesehen, sondern als von ihm, dem Einen, gehalten (Hegel: „weit entfernt, das Unvernünftige zu sein“). Wenn wir aber fragen: Wie können wir diese Einheit für unser Bewußtsein wiedergewinnen oder wenigstens hoffen und glauben lernen?, so weist Natorp uns an, suchend und lesend – so, wie er das Lesen verstand – zu den großen Denkern und großen Gläubigen zu gehen. Nicht verspricht er Harmonisierung; denn er glaubt mit Heraklit: „Das Eine, mit sich selbst im Widerstreit geraten, wird sich zusammenfinden“ und nur so das Leben immer tiefer und die Erkenntnis immer weiter wachsen. Bios: Wirtschaft, Recht, Staat und Erziehung brauchen nicht von unten aufzubauen, aber alles vollendet sich nur in der Gemeinschaft von unten auf und bis unten hin zur Wirklichkeit. Das Ganze der Menschengemeinschaft ist Erziehungsobjekt und Erziehungsinstanz, kein Einzelner. – Es gibt keine höhere Sinngebung als die in Natorps Philosophie.
1 Ich danke Dr. Christian Tilitzki für die Mitteilung zweier Briefe bereits vor Veröffentlichung. Auch Prof. Gerald Hartung hat mich freundlich beraten.
2 Natorps Sohn Hans beobachtete z.B. die Nähe von Hartmanns sog. „Circel“-Gesprächen (seit den 20er Jahren) zu den Seminaren seines Vaters: Hartmann habe „ausgebaut und anscheinend vervollkommnet, was auch meinem Vater nachgerühmt wurde, ja was er [Hartmann] selbst meinem Vater nachrühmte: Das Disputieren philosophischer Probleme mit Jüngeren, dem Nachwuchs, auf Spaziergängen und im Seminar, auf anscheinend der Grundlage der Gleichberechtigung.“ [2. S. 21] – Von solchen „systematischen Übungen“ erzählt auch unser Vortrag (s.u. S. {3}).
About the authors
Nicolai Hartmann
Author for correspondence.
Email: wiedebach@posteo.de
German philosopher
Hartwig Wiedebach
Email: wiedebach@posteo.de
Dr. Phil. Habil., Independent Scholar Göppingen, Germany
References
- Tilitzki Ch, editor. Nicolai Hartmann - Heinz Heimsoeth. Briefwechsel 1921-1950. Berlin: Duncker & Humblot; 2024.
- Fischer J, Hartung G, editors. Nicolai Hartmanns Dialoge 1920-1950. Die “Cirkelprotokolle”. Berlin/Boston: De Gruyter; 2020.
Supplementary files