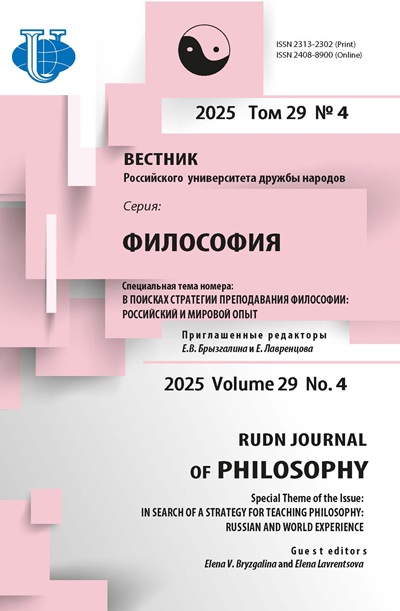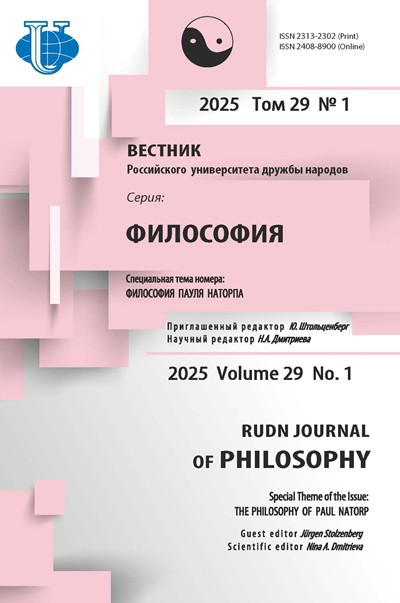Paul Natorp as Musician, Composer and Music Theorist: А Historical-Biographical Sketch
- Authors: Stolzenberg J.1
-
Affiliations:
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- Issue: Vol 29, No 1 (2025): THE PHILOSOPHY OF PAUL NATORP
- Pages: 7-21
- Section: THE PHILOSOPHY OF PAUL NATORP
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/43527
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2025-29-1-7-21
- EDN: https://elibrary.ru/DQBHHV
- ID: 43527
Cite item
Full Text
Abstract
The musician and composer Paul Natorp has not been recognised in research. The references in his Self-Presentation (Selbstdarstellung) (1921) to the importance of music, especially in his early years, have so far remained unacknowledged. The musical legacy and previously unpublished diaries and letters provide more detailed information. They demonstrate the young Natorp’s passionate relationship with music. In addition, it becomes clear that Natorp was active as a composer throughout his life. The article starts by describing the musical legacy. At the centre is the correspondence with Johannes Brahms, to whom the young Natorp submitted some of his compositions for review. Brahms strongly advised against a career as a musician and composer. Also significant are reports from the young Natorp about his composition studies with the musicologist and composer Gustav Jacobsthal (1845-1912) in Strasbourg. Reports on concerts with Clara Schumann and Franz Liszt are biographical and cultural-historical documents. The article concludes with a sketch of Natorp's reflections on the world-historical significance of Ludwig van Beethoven’s music.
Keywords
Full Text
„De nobis ipsis silemus“ – Von uns selbst schweigen wir, so beginnt Paul Natorp seine Selbstdarstellung aus dem Jahre 1921 [1], mit einer doppelten Referenz an Francis Bacon, der damit das Vorwort zu seinem Novum Organum eröffnete und an Immanuel Kant, der Bacons Vorwort seiner Kritik der reinen Vernunft als Motto vorangestellt hatte. Nicht von sich selbst, sondern von der Sache soll die Rede sein, und diese Sache ist die Philosophie. Gleich zu Beginn der Selbstdarstellung ist aber auch von Musik die Rede, von der Musik Bachs, Beethovens und Wagners, von ihrer Nähe zur Philosophie, und dass sie es war, die den jungen Studenten, wie es da heißt, „für Jahre völlig in Bann schlug“ [1]. Der alte Natorp verschweigt indessen, dass die Musik niemals aufgehört hat, ihn in ihren Bann zu ziehen und dass sie ganz wesentlich mit zu der Sache gehört, um die es ihm zeitlebens ging. Das allerdings ist bis heute so gut wie unbekannt geblieben. Von Paul Natorp als Musiker und Komponist ist in der gelehrten Forschung keine Rede. Darüber gibt der musikalische Nachlass Auskunft.
Der musikalische Nachlass
Der musikalische Nachlass Paul Natorps befindet sich im Westfälischen Musikarchiv Hagen. Er umfasst ca. 100 Lieder aus den Jahren 1885 bis 1915, 2 Chorwerke und mehrere Kammermusikwerke. Er wird in Hagen seit dem 10. Juli 1973 aufbewahrt. An diesem Tag erhielt das Westfälische Musikarchiv Hagen ein Paket mit Musikalien, abgesendet von Hanna Natorp, der Frau von Hans Natorp, dem Sohn Paul Natorps, der 1973 verstorben ist. Am 20. Juni 1977 sandte der andere Sohn Paul Natorps, Hartwig Natorp, aus Zürich die ihm überlassenen Bestände aus dem musikalischen Nachlass Paul Natorps ebenfalls an das Westfälische Musikarchiv Hagen.[1]
Von den Kompositionen Paul Natorps sind nur sehr wenige im Druck erschienen. Es handelt sich um einige Lieder und ein Klaviertrio in C-Dur. Unter den Autoren der von Natorp vertonten Gedichte finden sich die Namen von Goethe, Hölderlin, Rückert, Hebbel, Brentano, Eichendorff, Mörike, Keller, Avenarius, Richard Dehmel, Gustav Falke, Hermann Löns und anderen. An Klavierstücken enthält der Nachlass 6 Klavierstücke von 1899 und Drei Präludien und Fugen aus den Jahren 1907/08.
Folgende Kammermusikwerke liegen im Nachlass in handschriftlichen Partituren vor:
- Drei Klaviertrios, das erste in C-Dur von 1885, die beiden anderen in e-Moll und fis-Moll, ohne Jahresangabe;
- Lyrische Stücke für Violine und Klavier, ebenfalls von 1885;
- ein Klavierquartett, D-Dur von 1896;
- ein Klavierquintett („Quintuor“), Es-Dur von 1913;
- zwei Sonaten für Violine und Klavier, die eine in fis-Moll von 1904/05, die andere in a-Moll von 1899/1900;
- eine Sonate für Violoncello und Klavier, D-Dur von 1917.[2]
Der Bestand des musikalischen Nachlasses Paul Natorps zeigt, dass Natorp bis in seine späte Zeit hinein komponiert hat. Die Cello-Sonate von 1917 ist das späteste Werk, das im Nachlass erhalten ist. Auffallend ist, dass der Nachlass so gut wie keine Jugendkompositionen enthält.
Die Tagebücher (1873–1886) – Der junge Natorp und Brahms
Gezielte Recherchen zu Paul Natorp als Komponisten sind bisher nicht unternommen worden. Hier hat die Dokumentenlage allerdings eine signifikante Erweiterung erfahren. In der sprichwörtlichen Kiste auf dem Dachboden haben sich im Hause von Familie Lütcke-Natorp in Marburg zwölf Tagebücher aus den Jahren 1873 bis 1886 gefunden. Sie werden in der Universitätsbibliothek Marburg aufbewahrt.3
Sie sind in mehrfacher Hinsicht eine kleine Sensation. Im dritten Heft der von Natorp sog. Notizen findet sich in einem längeren rückblickenden und zusammenfassenden Eintrag unter dem 1. Februar 1875 die folgende Notiz: „Ich kam wegen meiner Kompositionen auf die tolle Idee – sie einfach Brahms zu schicken damit er sie beurteile, Karl[4] unterstützte mich riesig – ich beschloß es zu tun“ (III, 50).[5]
Das Tagebuch nennt auch die Stücke, die der junge Natorp an Brahms nach Wien schickte: „Mein Entschluss war fest und sofort gab ich mich an die Ausführung, schrieb bis Mittwoch alles zusammen: Dies irae endlich ausgeführt als „Phantasie über die Domscene in Goethes Faust“ und „Gretchens Lied im Kerker[“], dann die 4 Lieder (Warum weckst du mich. Auf dem See. Nun [Wort unleserlich] die Nacht. Ganymed)[6] ausserdem nahm ich das Adagio F-dur und die zwei Phantasiestücke, schickte alles, mit einem mutigen und bestimmten 4 Seiten langen Brief nach Wien; nun „mit Spannung Ihre gütige Antwort erwartend“ bebe ich vor der Entscheidung, möge sie nicht zu lange ausbleiben!“ (III, 52).[7]
Die für Brahms’ Gepflogenheiten ungewöhnlich schnelle Antwort traf noch im Februar ein. Brahms schreibt:
[Auf dem Briefumschlag:]
Herrn
Paul Natorp
stud. phil.
Strassburg im Elsass.
Alter Fischmarkt 36. II.
Jan 75
Geehrter Herr,
Ich möchte nicht gern Ihren Brief unbeantwortet lassen u. so bitte ich um Erlaubniß kurz u. eilig schreiben zu dürfen.
Ich kann nicht umhin Ihnen den Rath zu geben bei Ihren bisherigen Studien zu bleiben u hoffe aus Ihrem Brief richtig zu ersehen dass Sie diese bis jetzt nicht vernachlässigt haben.
Ich möchte zwar durchaus nicht zugeben dass eine ernstere Beschäftigung mit unserer Kunst eine „werthlose Spielerei“ sei – ebensowenig jedoch nimmt es mich wunder wenn ein junger Mann Talent u. Zeit genug hat, neben seinen eigentlichen Studien poetische oder musikalische Produkte zu liefern wie die mir vorliegenden. Daß in diesen ein „richtig getroffener Inhalt zu klarem Ausdruck“ gebracht sei, darf ich nicht sagen, leider nicht einmal daß sie „eine gewisse, leicht zu gewinnende Fertigkeit sich der übl. mus. Formen zu bedienen“ bekunden.
Widerspäche nicht Ihr Brief, so möchte ich die Sache am liebsten damit loben: dass dem Verfaßer wohl die Schwierigkeit ein Kunstwerk zu schaffen klar sein könne. Mich erfreut bei Ihrem Anblick der Gedanke an einen ernsten o. guten Liebhaber unserer Kunst. Bedenken Sie wie schwierig und fraglich es ist in Ihrem Alter einen neuen – doch ziemlich unbekannten Weg zu betreten. Nach den vorl. Proben kann ich nicht ernstlich genug zu solchen Bedenken raten. Daß man in einem Fall wie diesem, ungern nur das Papier sieht u. urtheilt brauche ich kaum zu sagen.
Ich hoffe Sie haben einen ehrlichen Rath auch ehrlich gewünscht?
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Der junge Paul Natorp vertraut seinem Tagebuch hierzu das Folgende an: „Montag früh [es war ein Rosenmontag – J.S.] kam die Antwort von Brahms die mich ziemlich vernichtete. Den Morgen arbeitete ich noch, den Nachm[ittag] nachdem ich mit Carl gesprochen hatte und der mir jede Hoffnung / genommen war ich sehr elend und schrieb einen sehr thörichten Brief, irrte dann im Schnee herum bis 7“ (III, 57/58).
Dieser nun als „sehr thöricht“ bezeichnete, bisher unveröffentlichte Brief hat sich im Brahms-Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien erhalten.9
Strassburg
Verehrtester Herr Direktor!
Es ist meine Pflicht, Ihnen für Ihre offene und klare Antwort zu danken; daß dieselbe meine Hochachtung für Sie nur erhöht, brauche ich nicht zu sagen. Wie gern schriebe ich Ihnen, daß sie mich auch befriedigte – wenn mich nur nicht mein eigner Sinn Lügen strafte! Werden Sie mich nicht für einen Narren halten, wenn ich nach solcher Entscheidung noch Zweifel habe? Wohl, aber ich bin sehr unglücklich. Ich weiß sehr genau, genauer, als Sie aus meinem Briefe entnommen zu haben scheinen, daß der Werth dieser Sachen als Kunstwerke keiner ist, daß sie wild und styllos sind. Aber das unwiderstehliche Bedürfniß, Gedanken, die uns ganz beherrschen, los zu werden, die fesselnde Macht, die ein selig empfundenes Ideal auf uns übt, gibt die uns wirklich nur trügerisch den Glauben an die Richtigkeit dieses Ideals? Wenn in der aufgeregtesten Zeit der Jugend wo so tausenderlei Neues zugleich auf uns einstürmt, die Liebe zu diesem Ideal eine so leidenschaftliche war, daß sie keine ruhige Wirkung aufkommen ließ, konnte ich nicht denken, daß Ruhe und Klarheit erlernt, entwickelt werden konnte? Eine Leidenschaft kann täuschen; aber auch dann, wenn sie alle Tiefen der Seele erfaßte und sie fester und fester hielt, je mehr sie sich losreißen wollte? auch dann, wenn sie glüht, heiß glüht und zu versengen droht? und wenn sie das wunderbarste vollbringt, uns dann doch wieder die Ruhe und Klarheit, die sie uns entriß, doppelt zurückzugeben? Thun das Phantome so wie wirkliche Dinge? und haben wir gar kein Mittel, uns vor solchen Phantomen zu retten.
Ich muß in der That das unglückseligste Geschöpf der Erde sein, wenn mir diese Leidenschaft gegeben ist, ohne jede Fähigkeit, ihrer Herr zu werden und sie zu vernünftigem Zweck zu leiten. Was helfen mir die besten philologischen und sonstigen Anlagen, wenn mir diese Leidenschaft völlig die Ruhe und Concentration benimmt, die jeder Beruf verlangt? Ruhe und Concentration fände ich – das fühle ich nur zu tief – allein in der Musik; schon oft ja wollte ich mich losreißen aber jeder Ton den ich spiele oder höre, jeder ruhige Augenblick bringt die alten Gedanken wieder – ich kann sie nicht übertäuben außer wenn ich mich selbst übertäube. Die Musik aber ist mir, wie sie mir versichern, verschlossen, und so kann auch ich nichts mehr, als – mich auch verschließen.
Halten Sie diese Zeilen für was Sie wollen; Sie werden lächeln, mich vielleicht bedauern, wie man einen Irrsinnigen bedauert. Daß Sie antworten, kann ich nicht verlangen noch erwarten, Sie haben geantwortet, freimüthig und wohlwollend, wie ich es nicht erwarten durfte; ich liebe Sie darum, wie ich wenige liebe – doch auch das sollte ja nicht sein, und so ist’s vielleicht besser, Sie schreiben mir nicht. Wissen Sie aber eine Antwort, die mir in meiner Lage helfen könnte, können Sie nur etwas von dem, was mich zu zerstören droht, mildern, so werden Sie einen Unglücklichen – wenn auch nach Ihrer Ueberzeugung durch eigne Schuld unglücklichen eines Rathes nicht für unwerth halten.
Ich verbleibe in inniger Verehrung
Ihr ergebener
Paul Natorp
Wenige Zeilen nach dem oben zitierten Eintrag im Tagebuch liest man: „Ich bin elend und arm, weiß nichts mehr was mir Interesse abverlangt, hasse geradezu alles was Musik und Poesie heißt. So wäre denn alles Selbsttäuschung, elende Selbsttäuschung“ (III, 58).
Und weiter: „Ich trage nicht leicht. Nach augenblicklichem Wiederaufleuchten der alten Hoffnungen ist die Verzweiflung umso finsterer. Ich arbeitete die Woche nicht viel, führte ein erbärmliches Leben“ (III, 58).
Allzu schlimm muss es denn doch nicht gewesen sein. Das „erbärmliche Leben“ dauerte nicht lange. Bald findet man den jungen Natorp wieder am Klavier, in Wagner und „Siegfried, der gerade herausgekommen“ war, schwelgend: „Das Ding“, so notiert Natorp, „ist unanständig genial – groß – / schön und dabei rührend einfach. Nichts ist mir so unentbehrlich, kein Beethoven u. Schumann u. Brahms“ (III, 60-61).
Natorps Wagnerverehrung wird noch lange andauern, wie zahlreiche weitere Eintragungen hier und in den folgenden Tagebüchern belegen. Mit Brahms hat der junge Natorp aber denn doch nicht gebrochen: „dennoch“, so fährt der Eintrag fort, „hoffe ich den letzteren noch sehr lieb zu gewinnen trotz seines boshaften Briefes. Daß er mir nicht antwortet ist recht von ihm“ (III, 61).
Hält man sich die Situation des jungen Paul Natorp in Straßburg, so, wie sie aus den Eintragungen des Tagebuchs deutlich wird, vor Augen, dann war bei dem Entschluss, Brahms um ein Urteil über die eigenen Kompositionen zu bitten, wohl eine gute Portion Naivität, gepaart mit jugendlichem Übermut, im Spiel.
Kompositionsstudien bei Gustav Jacobsthal
Die Vermutung liegt nahe, dass der junge Natorp sich in seiner „tollen Idee“ wohl auch von einem Fachmann bestätigt sehen durfte. Unter dem 14. November 1874 berichtet das Tagebuch Folgendes: „Ich spielte Jacobsthal meine Kompositionen (nur die Lieder) vor, er nahm kaum viel Rücksicht darauf, gab kein entscheidendes Urteil und nahm mich mit dem Bescheid ich habe viel Talent, [müsse] aber noch vieles d. h. alles erst von vorne an lernen, in die Lehre“ (III,12).
Dem ist zu entnehmen, dass der junge Paul Natorp seine Kompositionsversuche Gustav Jacobsthal (1845–1912) vorlegte, der ab 1872 als Privatdozent, seit 1875 als außerordentlicher und von 1897 bis 1905 als ordentlicher Professor für Musikwissenschaft an der Universität Straßburg wirkte.[10] Jacobsthal bekleidete das erste Ordinariat für Musikgeschichte und Musiktheorie an einer deutschen Universität. Darüber hinaus kommt ihm das Verdienst zu, mit seinen umfangreichen und innovativen Forschungsarbeiten zur Rekonstruktion der Musik des Mittelalters, insbesondere mit Bezug auf Fragen der Melodiebildung und der rhythmischen Gestaltung mittelalterlicher Musik, die musikwissenschaftliche Mediävistik in Deutschland begründet zu haben. Seine Forschungen galten aber auch der Geschichte der Oper und dem frühen Mozart. Darüber, z. B. über ein Kolleg zu Gluck, berichtet das Tagebuch an einigen Stellen.
Jacobsthals Kolleg war es denn auch, durch das Natorp zu einem neuen und intensiveren Studium der Werke Brahms’ angeregt wurde. Ein Student, Richard Schubring, „stud iur.“, hatte im Kolleg, wie Natorp notiert, „gelegentlich Brahms gepriesen, Wagner verachtet“ (III, 31) und Brahms, wie es weiter heißt, „beinahe über Schumann“ gestellt. „Eben dies“, so notiert Natorp, „kannte ich bisher nicht an ihm und so war ich neugierig gemacht“ (III, 30). Insbesondere die Balladen beeindrucken ihn nun, sodann die „Fismoll-Sonate, deren zweiter Satz colossal schön“ ist, später Lieder (III, 41). „Empfindungstiefe“, so fasst der junge Brahmsverehrer seinen Eindruck zusammen, „colossale Beherrschung der musik.[alischen] Mittel, besonders der bedeutendsten lyrischen, ist unleugbar; colossale Beherrschung statt der so häufigen Beherrschtheit nimmt jeden kräftig empfindenden sofort ein“ (III, 32). Und später heißt es: „Brahms hält mich in Athem“ (III, 40).
Jacobsthals eigene Kompositionen und seine musikästhetischen Ansichten wird man wohl als traditionalistisch, wenn nicht gar im Blick auf den ‚Geist der Zeit’ als rückwärtsgewandt bezeichnen dürfen. Aus der so genannten Berliner Schule der Cäcilianisten, d.h. der Tradition der Berliner Singakademie mit ihren Mentoren Carl Friedrich Zelter, Eduard Grell und Heinrich Bellermann herkommend, schrieb er, außer einem Streichquartett und mehrerer Klavierlieder, vornehmlich Chorsätze im Palestrina-Stil mit einem romantisierenden Einschlag, für die er Texte aus dem Alten Testament auswählte. Für den jungen, ganz in der romantischen Musik lebenden und webenden Natorp dürfte der Unterricht bei Jacobsthal ein hartes Brot gewesen sein. Das bestätigt die folgende Notiz: „Jacobsthal plagt mich sehr und doch geht’s langsam genug vorwärts“. Worin die Plage besteht, wird aus folgendem Eintrag deutlich: „Ich soll möglichst viele, zahllose „Melodien“ bauen, ganz ohne jede Mitte, nur Anfang und Ende ohne jede rhythmische Einteilung / und Betonung nach dem Prinzip des bequemen und regulären Melodieschrittes. Es lebe das einfach-Schöne!“ (III,12/13).
Im Unterricht war offenbar aber auch die Begutachtung von selbständigen Kompositionen vorgesehen: „ich habe ihm auf Verlangen auch meine Sonate gegeben und bin gespannt was er dazu sagt“ (III, 21).
Es ist unklar, um welche Sonate es sich gehandelt hat. Offensichtlich war Jacobsthal zufrieden, denn ein diesbezüglicher Bericht hält fest: „Bei Jacobsthal war ich wieder – nach einigem Fehlen, er ist immer zufrieden und drängt zum Fortschritt“ (III, 22).
Von Natorps frühen Kompositionen ist, wie erwähnt, im Nachlass nichts erhalten. Die Stücke, die im Wiener Brahms-Archiv aufbewahrt werden, sind die im Tagebuch genannten Phnatasiestücke, kleine, schlicht gehaltene Stücke für Klavier. Dass der junge Natorp noch andere, offenbar anspruchsvollere Stücke übersandt hat, ist der oben zitierten Aufstellung zu entnehmen. Von den eingesandten, ebenfalls im Tagebuch genannten Liedern, auf die Brahms sich bezieht, ist im Wiener Brahms-Archiv ebenfalls nichts erhalten. Dass der junge Natorp recht ambitionierte Projekte verfolgte, ist auch aus anderen Tagebuch-Eintragungen zu schließen. Neben der „Domszene“, „die im Kopf fertig und auf dem Klavier probiert“ (III, 34) ist – es ist die in der oben zitierten Aufstellung der Sendung an Brahms genannte „Phantasie über die Domscene in Goethes Faust“ –, ist die Rede von „Chor-Partien des ersten und zweiten Aktes, [die] ziemlich feststehend“ seien. Es handelt sich wohl um Pläne zu einer Oper mit dem Titel „Sappho“. Wiederholt wird eine Sappho-Ouvertüre erwähnt, die „mit viel Not […] endlich zu Papier“ gebracht wird – „drei Tage tat ich fast nichts Anderes“ (III, 35). Auch dazu hat sich im Nachlass nichts erhalten. Brahms’ „ehrlicher Rat“ hat seine Wirkung zwar nicht verfehlt, doch hat Natorp sich offenbar nicht entmutigen lassen, weiterhin zu komponieren. Das Komponieren und das leidenschaftliche, tägliche Spiel am Klavier durchziehen das gesamte Straßburger Tagebuch und auch die folgenden Hefte: „… ich meist ganz in Musik verloren – o weh mir!“ (III, 14). Oder: „Sonntagfrüh spielte ich rasend (G-Moll Schuhm. Fis-Moll Br u.a.)11 und bemerkte dabei nicht, dass ein Gewitter war“ (III, 78).
Bachs Wohltemperiertes Klavier, Haydns Sonaten, Mozarts Opern und Kammermusik, von Beethoven die Sonaten, die Kammermusik und die Sinfonien, die Klavier-, Kammermusikund sinfonische Literatur von Schumann, Schubert und Brahms, vor allem aber Wagner ist die bevorzugte Literatur. Daneben finden sich aber auch Berichte über das Studium bei dem Philosophiehistoriker Ernst Laas, das den jungen Natorp zu einer intensiven Kant-Lektüre und zur Auseinandersetzung mit Laas’ empiristisch-positivistischer Kant-Interpretation anhält. Daraus ergibt sich dann die folgende thematische Engführung: „Ich studierte die Kritik der reinen Vernunft, spielte Siegfried u.a. auf dem / herrlichen neuen Flügel“ (III, 5/6).
Das kann als Motto für das Leben und die geistige Atmosphäre des jungen Paul Natorp in Straßburg stehen. Die anderen Tagebücher, die erhaltenen Kompositionen und Hinweise in Briefen – so berichtet Natorp in einem Brief vom 4. Februar 1918 an seine Tochter Grete, die in Leipzig bei dem berühmten Cellisten Julius Klengel studierte, von der Arbeit an der Cello-Sonate, die er für sie geschrieben habe: „Das waren 8 Tage scharfe Arbeit, mehrmals bis in die tiefe Nacht“ –,[12] diese und andere Zeugnisse aus Briefen lassen deutlich werden, dass die Verbindung von Philosophie und Musik doch nicht nur für die Straßburger Zeit und nicht nur für den musikbegeisterten Studenten Paul Natorp galt. Es darf in Wahrheit als Motto für das Leben des Philosophen wie des verschwiegenen Komponisten Paul Natorp insgesamt gelten.
Bevor ich mit Wenigem auf den Musiktheoretiker Natorp zu sprechen komme, seien noch zwei Tagebuchberichte vorgestellt, deren Bedeutung über den engeren biographischen Rahmen hinausreicht. Es handelt sich um zwei Berichte von Konzerten mit Clara Schumann und Franz Liszt.
Berichte von Konzerten mit Clara Schumann und Franz Liszt
Unter dem 10. Oktober 1875 notiert Natorp das Folgende: „Heute Abend ist Bachverein mit Frau Schumann! [Der Konzertzettel ist an dieser Stelle im Tagebuch eingelegt.] Nach wundervoller Herbstbeleuchtung den Abend (im Hofgarten) in´s Concert, sehr voll, sehr fein, sehr lang – aber schön! Ein Chor von Bach, dann von Brahms In stiller Nacht zur ersten Wacht etc. und Mendelssohn, Herbstlied (a capella) wunderschön. [...] Dann spielte Frau Schumann die kromat. Phantasie langweilig und die Fuge, gut. Folgte ein Chor mit Solo (Fräulein Mass) und Orgel, Laudate Dominum v. Mozart nicht besonders. Zwei hübsche Chöre von Rheinberger, dann C-Dur Sonate v. Beeth. op. 53. bes. das Finale packend und energisch (das Adagio zu schnell u. ohne Ausdruck). Sie spielt nicht so ganz außerordentlich, aber sehr ordentlich, bes. in der Technik [...] / Frau Schumann spielte dann das Abendlied Opus 85 herrlich, dann Nachtstück Nro. 4. nach unser aller Meinung viel zu schnell und flach, dann vollendet schön die Novellette E-Dur und wurde auch reichlichst beklatscht. Folgten Brahms Liebeslieder Walzer die ich zum 1. Mal hörte [...] wenn jemand wissen will was originell ist – der höre diese Dinger“ (V, 10/11).
Nach der Aufzählung und Kommentierung der letzten Programmpunkte schließt der Bericht: „Diesmal war doch alles froh, als es zu Ende war“ (V, 11).
Glanzvoller und begeisternder geriet das Konzert mit Franz Liszt am 30. April 1876 in Düsseldorf, über das das Sechste Heft der Tagebücher berichtet, das Natorp 1876 in Dortmund führte, wo er eine Hauslehrerstelle angenommen hatte. Unter dem 1. Mai findet sich der folgende Eintrag: „1. Mai im schönsten Regen – soeben aus Düsseldorf zurück – Liszt! Und alles erlebt“ (VI, 67).
Der Konzertbericht beginnt wie folgt: „Liszt kam herein, u. gefiel mir gut, dann mit Tusch und Hochrufen begrüßt, auch Ratzenberger lebhaft begrüßt“ [es handelt sich um den Liszt-Schüler, Dirigenten und Komponisten Edmund Theodor Ratzenberger (1840–1879)] (VI, 68).
Das erste Stück, Liszt’s sinfonische Dichtung Prometheus, von Ratzenberger dirigiert, erscheint Natorp eine „vergleichsweise verständliche eingängliche Musik“, die „aufs herrlichste exekutiert“ wird. Als Glanzund Höhepunkt wird der „Schnitterchor“[13] gerühmt. Der erste Teil endet mit Jubel und Hochrufen, ein Musikkranz wird überreicht, Dankesworte werden gesprochen: „Pause – Lärm u. Gedränge, wir retteten uns ins Freie, Ruhe war nötig, denn die Hauptanstrengung stand noch bevor“ (VI, 69).
Diese „Hauptanstrengung“ war eine Messe von Franz Liszt. Es handelt sich um die „Missa solemnis zur Einweihung der Basilika in Gran“, bekannt auch unter dem Titel „Graner Festmesse“. Liszt vollendete sie 1855, 1856 wurde sie in Gran mit großem Erfolg uraufgeführt. Die Besetzung sieht 4 Soli, gemischten Chor und großes Orchester mit Orgel vor, die Dauer beträgt ca. 70 Minuten. Von ihr zeigt sich der junge Natorp auf höchste beeindruckt, ja, wie er schreibt, „hingerissen“ – auch wenn „das Werk dem Publikum zu schwer und zu tief“ war und dieses „unter aller Würde kalt“ blieb.
„Das Werk“, so fährt der Bericht fort, „überragt nicht nur den Pr[ometheus] (der das Publikum so interessiert hatte), sondern alles was ich bisher von L.[iszt] kenne bei weitem und rückt den Mann trotz allem was sich sonst an ihm aussetzen ließe unter die Riesen seiner Zeit, würdig neben Wagner zu stehen u. allen übrigen vielleicht an Genialität und Großartigkeit [u.] Empfindung überlegen. Brahms ist so viel echter [?] ins Herz gehend, sympathisch ansprechender, aber alles was er auch nach der Seite der gewaltigen Tiefe geleistet haben mag, bleibt vielleicht unter diesem einen köstlichen Werk. [...] Übrigens bin ich nicht der Einzige, der so urteilt, Vater, der sehr geschimpft hatte, und auch Mutter waren nicht minder hingerissen als ich, und so saßen wir drei und ließen uns alle [?] umstandslos – überliszten wie Vater sagte“ (VI, 69).
Am Ende fast der junge Natorp seinen Eindruck so zusammen: „Nirgends war ich so ganz mit jedem Ton einverstanden, nirgends fühlte ich so die Ebenbürtigkeit dieses Werkes mit den Größten, mit einem Beethoven – an der 9. hat L[iszt]. viel gelernt, aber daraus nur lernen zu können ist Zeugnis einer geistigen Ebenbürtigkeit die vielleicht gar einem Brahms abgehen dürfte“ (VI, 70).
Das hinderte den jungen Natorp nicht, sich in Brahms’ Deutschem Requiem zu vertiefen und sich nachhaltig von ihm begeistern zu lassen. Die späteren Tagebücher, insbesondere aus der Marburger Zeit, berichten immer wieder von leidenschaftlichem Brahms-Spiel. Hier allerdings ist Liszt der Star. Der Bericht schließt: „Kurz, seit der großen Messe habe ich wieder einen großen Geist mehr zu verehren – Lorbeerkranz etc. blieb nicht aus, aber die Messe selbst fand eigentlich nur einen succès d’estime. Trotz Anwesenheit des Komponisten solche Kälte! Das ist echt Düsseldorfisch Platt. Die Kölner und viele räsonierten, dass ich mir die Ohren zuhalten wollte – wenn’s ihnen nur gut bekommen ist!“ (VI, 72). Man darf vermuten, dass Natorps Begeisterung für die Lisztsche Messe unter anderem der romantischen Auffassung der Musik als höchster Domäne der Kunstreligion geschuldet ist. Dem kann hier nicht weiter nachgegangen werden.
Liszt selbst hörte der junge Natorp am nächsten Morgen in einer „Probe eines zweiten Konzerts“. Das Tagebuch berichtet darüber das Folgende: „Liszt war sehr munter und lebhaft, überaus eifrig, liebenswürdig, witzig, dass er alle Damen bezauberte. [...] nach vielem Rücken und Deliberieren, setze sich Liszt ans Klavier und spielte mit Heckmann (u. etwas Harmonium–Begleitung) das Benedictus aus der Krönungsmesse, eine Komposition von großem Werte, die nur gar wenig von einem Benedictus hat – es ist eine Art von – ungarischer Rhapsodie. Heckmann spielte herrlich, Liszt natürlich, frei, genial, doch hier noch gebundener, sittiger. Er wurde begeistert beklatscht und bejubelt und schüttelte Heckmann die Hand. Er sieht so stolz aus, wenn er seine eigenen Schöpfungen spielt und wenn er gelegentlich über die Noten zum Publ.[ikum] / herüberlacht und verzieht sein Gesicht. Man sieht der ganze Mensch lebt in der Musik, nicht nur seine Finger und eine verborgene Kammer seines Hirns“ (VI, 73/74).
Nach einer missglückten Chorprobe – „Man konnte leider kein A herausbringen, blieb immer und immer zu tief“, und auch der Solist, der Bariton Fessler, sang zu tief – setzte sich Liszt noch einmal ans Klavier – „mit Ratzenberger, und sie spielten die Fantasie u. Fuge über B A C H f. 2 P[iano]f[or]te (ein Instr. mit zwei Klaviaturen!)14 wild genial u. barbarisch schwierig, Ratzberger [sic!] kam barbarisch mit und machte seinem Lehrer alle Ehre. – hier zeigte sich Liszt’s Spiel von seiner größten Genialität – er legte jetzt, in der Probe, einmal ganz ungeniert / los, ungenierter vielleicht als im Konzert und die Kompos[ition]. gab ihm alle Geleg[enhei]t., die ganze Großartigkeit seines Spiels zu entwickeln – dieselbe ist höchst genial, aber für niemand als einen Liszt und einen Ratzenberger spielbar – keine strenge Fuge natürlich, sondern mit allen erdenklichsten Freiheiten – sehr nach meinem Geschmack (Thema: b a c h / [Zeichen für Achtelpause] f e b a es d as / g g mit Tempo Verschiedenheiten zu großartigster Vielstimmigkeit, zuletzt zu einem seiner hinreissenden Accelerandi [...] Bei einer der großartig-tollsten Stellen hielt er inne und rief zu Ratzenberger hinüber: Famos! – Lachen und Jubel des Publikums, er spielte es nochmals u. nochmals u. nochmals. Endloser Jubel beendete den denkwürdigen Morgen“ (VI, 74/75).
Soweit der Einblick in Natorps Tagebücher. Sie sind, das dürfte deutlich geworden sein, bewegende historisch-biographische Dokumente, bedeutende Dokumente der Bildung und Kultur der Zeit und höchst persönliche Konfessionen des jungen Paul Natorp in einem.
Paul Natorp als Musiktheoretiker
Zur Beethoven-Deutung
Der reife Natorp hat der Musik noch einmal eine Bedeutung zuerkannt, die über den Bereich des Persönlichen weit hinausreicht. Wie vor ihm Nietzsche und nach ihm Thomas Mann hat Natorp die Musik nicht nur als künstlerisch-symbolischen Ausdruck kollektiver emotionaler Gehalte, sondern welthistorischer Tendenzen verstanden, die sich vor allem in der deutschen klassischen Musik manifestieren. Leitfigur ist Ludwig van Beethoven. Die Musik Beethovens ist für den reifen Natorp der Gipfel der künstlerischen Produktivität und sinnstiftende Orientierung für das kulturelle und politische Leben im Deutschland seiner Zeit zugleich. Es scheint, als habe Natorp damit den frühen Erfahrungen einen theoretischen Ausdruck zu geben gesucht, der geeignet ist, zu einer Verständigung über das eigene intellektuelle Leben und das seiner Zeit beizutragen. Das, was es mit Beethoven zu verstehen gilt, sucht Natorp vor allem an der Dritten und Neunten Sinfonie darzustellen. Dies geschieht in kritischer Auseinandersetzung mit der Beethoven-Deutung Wagners wie derjenigen Paul Bekkers, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.15 Beethovens Eroica ist für Natorp Ausdruck einer Idee, und zwar der Idee, nicht eines personal verstandenen oder aber gänzlich abstrakt bleibenden, sondern historisch konkret gewordenen kollektiven Heldentums. In Beethovens Eroica, so läßt sich Natorps Hauptthese zusammenfassen, gewinnen unter dieser Idee die wesentlichen Tendenzen und das historische Schicksal der deutschen Geschichte und Kultur ihren symbolisch-künstlerischen Ausdruck. Bereits bei der Deutung der Eroica, vor allem aber der Neunten Sinfonie, tritt noch einmal das Motiv in den Vordergrund, das schon im Kunsterleben des jungen Natorp zu bemerken war, das Motiv der Kunstreligion, hier in Gestalt des Erhabenen in der Musik. Natorp deutet es als kämpferische Überwindung des Schicksals, die ihre Kraft aus dem durchaus Kantisch gefassten Postulat der Existenz Gottes – Schillers ‚lieber Vater überm Sternenzelt’ – als Garanten einer rechtlich-sittlichen Weltordnung gewinnt, in der die Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Freiheit ihren Halt und ihre Berechtigung finden kann.
Dies ist freilich eine Deutung, wie Natorp selber eingesteht, „aus der Stimmung unsrer Zeit“ (Weltberuf, 169). Sie geht darin aber nicht auf. Diesseits aller zeitgebundenen Thematik und Rhetorik lässt sich der rationale Kern der Beethoven-Deutung Paul Natorps in dem Konzept zusammenfassen, das man in Abwandlung der Kantischen Formel vom „Weltbegriff der Philosophie“ den Weltbegriff der Musik nennen könnte. Er betrifft, wie der Weltbegriff der Philosophie, „die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft“ (KrV, B 867) und damit das, „was jedermann notwendig interessiert“ (KrV, B 867, Anm.). In diesem Sinne spricht Natorp selber von der Musik als einer „kosmischen Philosophie“ (Selbstdarstellung, 152, Weltberuf, 162). Gemeint ist indessen nicht nur ihre welthistorische humane Bedeutung, sondern auch die durch die Musik Beethovens vermittelte Hoffnung, dass die Welt, in der die Menschen ihr Leben zu führen haben, es erlaubt, trotz aller Widerfahrnisse und Widrigkeiten doch ein gutes und gelingendes Leben im personalen wie im sozialen Sinn führen zu können. Die Musik Beethovens, insbesondere die von Natorp eindringlich beschriebene Neunte Sinfonie und das Finale mit der Vertonung von Schillers „Ode an die Freude“, erscheint unter dieser Perspektive als ästhetisches Symbol der Übereinstimmung zwischen den sittlich-praktischen Intentionen der Menschen und ihren Glückserwartungen [10]. Damit übernimmt Beethovens Musik die Funktion, die Kant der Instanz Gottes als eines Postulats der praktischen Vernunft zugewiesen hatte. Das ist der rationale Gehalt der Beethoven-Deutung Paul Natorps.
***
In seinem Nachruf zum Tode Gustav Jenners im Jahre 1920, der 25 Jahre lang als Universitätsmusikdirektor an der Universität Marburg tätig war und mit dem Paul Natorp eine enge Freundschaft verband, erwähnt Natorp, dass Jenner der einzige war, „der sich rühmen konnte, im eigentlichen Sinne Schüler von Brahms gewesen zu sein.“[16] Darin wird man die unausgesprochene Erinnerung an das ihm selber Versagte mithören dürfen. Im Nachruf auf den vom Schicksal Begünstigten erscheint so am Ende noch einmal das Lebensmotiv Paul Natorps, das versagende Schweigen – De nobis ipsis silemus.
1 Dass der musikalische Nachlass Paul Natorps im Westfälischen Musikarchiv Hagen aufbewahrt wird, ist aus der Tatsache zu erklären, dass die Familie Natorp ein altes Familiengeschlecht ist, das seine Wurzeln im Westfälischen Raum hat. So war der Urgroßvater Paul Natorps, Bernhard Christoph Ludwig Natorp (1774–1846), von Haus aus Theologe, als einflussreicher und geschätzter, am pädagogischen Werk Pestalozzis orientierter Beamter in der Schulverwaltung und als Generalsekretär mehrerer Vereine und als Politiker in Westfalen tätig. (https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Christoph_Ludwig_Natorp). Der Enkel Gustav Natorp (1824–1891) war als Gymnasiallehrer und Geschäftsführer des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund in Essen und als Abgeordneter des Kreises Altena-Iserlohn im Preußischen Landtag tätig (https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Natorp).
2 Hier sei auf die Doppel-CD, eine deutsch-russische Kooperation, mit Kompositionen Paul Natorps hingewiesen: Paul Natorp. Der Philosoph als Komponist. Sie enthält auch die an Brahms gesendeten und im Wiener Brahms-Archiv aufbewahrten Klavierstücke (zu den anderen an Brahms gesendeten Stücken siehe unten den Tagebuch-Eintrag „Mein Entschluss...“). Aufführungen von Kompositionen Paul Natorps fanden in neuerer Zeit in Marburg (2004), Sao Paulo (2005), Halle (Saale) (2005), Lübeck (2006), Moskau (2008) und Berlin (2009) statt. Die Sonate für Violoncello und Klavier wurde zuletzt in einem Gedenkkonzert am 12. September 2024 aus Anlass des 100. Todestages von Paul Natorp (17. August 1924) mit dem Ururenkel Paul Natorps, dem Cellisten Noé Natorp, und dem Pianisten Jean-Baptiste Doulcet im Rahmen des Kant-Jubiläumskongresses in Bonn im Beethovenhaus zusammen mit Brahms‘ Sonate e-Moll für Violoncello und Klavier op. 38 aufgeführt.
3 Nachlass Paul Natorp Universitätsbibliothek (Marburg). Zugriffsmodus: https://kalliope-verbund.info/
DE-611-BF-9345 (Letzter Zugriff: 08.11.2024).
4 Es handelt sich um Natorps Jugendfreund, den späteren Arzt, Anthropologen und Ethnologen Karl von den Steinen (1855–1929).
5 Die Tagebücher werden nach der originalen handschriftlichen Numerierung der Hefte und Seiten zitiert.
6 Johann Wolfgang von Goethe: Auf dem See (1775); Warum weckst du mich, Frühlingsluft? (aus: Die Leiden des jungen Werthers [1774]); Titel nicht verifizierbar; Ganymed (1774).
7 Natorps Begleitbrief ist nicht erhalten.
8 Der Brief befand sich ursprünglich im Privatbesitz von Frau Christel Natorp†. Am 5. April 2006 wurde er in Anwesenheit von Frau Christel Natorp dem Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck übergeben. Im digitalen Archiv des Brahms-Instituts ist er online einzusehen: Zugriffsmodus: https://www.brahmsinstitut.de/Archiv/web/bihl_digital/jb_briefe/2006_056.html (Letzter Zugriff: 08.11.2024).
9 Brahms-Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Brahms-Nachlass, Briefe Natorp an Johannes Brahms: 252,1.
10 Siehe hierzu ausführlich [2; 3].
11 Robert Schumann. Sonate für Klavier, g-Moll, op. 22; Johannes Brahms. Sonate für Klavier, fis-Moll, op. 2.
12 Der Brief befindet sich derzeit in Privatbesitz.
13 Es handelt sich wohl um: Johannes Brahms. Schnitter Tod, für gemischten Chor a capella, aus: Vierzehn Deutsche Volkslieder für gemischten Chor, WoO 43, Nr. 13.
14 Franz Liszt. Präludium und Fuge über den Namen BACH für Orgel (1855/56), Zweitfassung 1869/70, Klavierfassung 1871.
15 Cf. [4]. Zu Richard Wagners Beethoven-Deutung cf. Richard Wagner: Beethoven (1880), in [5]. Zu Paul Bekkers Beethoven-Deutung cf. [6] und ders. [7]. Zu Natorps Beethoven-Deutung ist auch der Vortrag [8] zu nennen.
16 Zum Gedächtnis Gustav Jenners. Bei der Trauerfeier zu Marburg am 1. September 1920 gesprochen von Prof. Paul Natorp, in: Neue Musikzeitung, Jg. 42 (1921), Heft 4, S. 59 f. Zu Gustav Jenner als Schüler von Brahms siehe [10]. Dem Brahms-Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien danke ich für eine Kopie des Briefs des jungen Natorp an Brahms und der Phantasiestücke für Klavier. Johannes Behr danke ich für wertvolle Hinweise zu Gustav Jenner und Brahms; Peter Sühring danke ich für Informationen zu Gustav Jacobsthal; Susanne Cordahi und Kurt Gärtner danke ich sehr herzlich für wertvolle Hinweise zum Nachlass von Paul Natorp. Gabriel Jira danke ich für Hilfe bei der Einrichtung des Textes für den Druck.
About the authors
Jürgen Stolzenberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Author for correspondence.
Email: juergen.stolzenberg@phil.uni-halle.de
Dr. Phil., Professor, Seminar for Philosophy 26/27 Emil-Abderhalden-Str., Halle (Saale), D-06108, Germany
References
- Schmidt R, editor. Die deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Mit einer Einführung, Erster Band. Felix Meiner; 1921. S. 151-176.
- Sühring P. Gustav Jacobsthal. Ein Musikologe im deutschen Kaiserreich. Musik inmitten von Natur, Geschichte und Sprache. Eine ideen- und kulturgeschichtliche Biografie mit Dokumenten und Briefen. Hildesheim: Olms; 2012.
- Sühring P. Gustav Jacobsthal. Glück und Misere eines Musikforschers. Berlin: Hentrich und Hentrich; 2014.
- Natorp P. Deutscher Weltberuf. Eugen Diederichs; 1918. S. 162-175.
- Wagner R. Dichtungen und Schriften. Jubiläumsausgabe in zehn Bänden. Borchmeyer D, editor. Band 9. Frankfurt am Main: Insel Verlag; 1983. S. 38-109.
- Bekker P. Beethoven. Schuster & Loeffler; 1911.
- Bekker P. Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler. Schuster & Loeffler; 1918.
- Natorp P. Beethoven und wir. Elwertsche Verlagsbuchhandlung; 1921.
- Stolzenberg J. Freude und Enthusiasmus. Kant-Schiller-Beethoven. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie. Heft 1. Hildesheim: Olms; 2023. S. 41-54.
- Behr J. Johannes Brahms. Vom Ratgeber zum Kompositionslehrer. Kassel: Bärenreiter; 2007.
Supplementary files